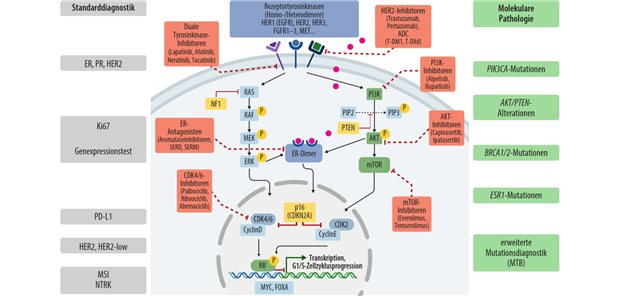Evaluation
Mammografie-Screening senkt Brustkrebssterblichkeit um 20 bis 30 Prozent
Die Teilnahme am Mammografie-Screening senkt nachweislich die Brustkrebs-Mortalität. Gesundheitsministerin Warken zeigt sich erfreut – und gießt Wasser in den Wein: Bei der Teilnahmerate bleibt noch viel Luft nach oben.
Veröffentlicht: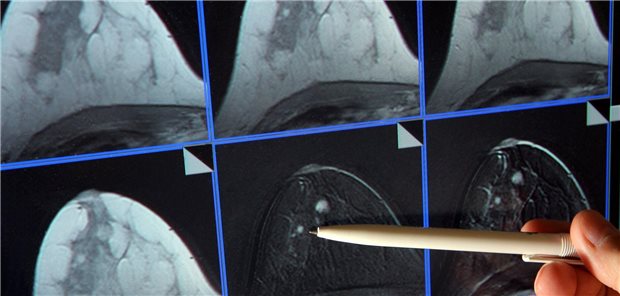
Frauen von 50 bis 69 Jahren – seit dem vergangenen Jahr nun bis 75 Jahre – erhalten alle zwei Jahre eine Einladung zum Mammografie-Screening. (Symbolbild)
© Jan-Peter Kasper/dpa-Zentralbild/dpa
Berlin. Durch das Mammografie-Screening-Programm verringert sich die Brustkrebssterblichkeit bei Frauen um 20 bis 30 Prozent. Das ergibt sich aus der Evaluation des vor 20 Jahren gestarteten bundesweiten Programms. „Ich freue mich über die Ergebnisse“, sagte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bei der Vorstellung der Ergebnisse am Mittwoch in Berlin.
Das Programm geht auf einen fraktionsübergreifenden Beschluss des Deutschen Bundestags im Juni 2002 zurück. In den Jahren 2005 bis 2009 wurde das Screening-Programm flächendeckend aufgebaut. Frauen von 50 bis 69 Jahren – seit dem vergangenen Jahr nun bis 75 Jahre – erhalten alle zwei Jahre eine Einladung zur Früherkennung.
Mit der hochwertigen Beurteilung der Mammografie-Aufnahmen seien Maßstäbe gesetzt worden wie in keinem anderen vergleichbaren Screening-Programm, sagte Warken.
70 Prozent Teilnahmerate waren ursprünglich das Ziel
Von der seinerzeit angestrebten Teilnahmerate von 70 Prozent sei man allerdings „noch ein gutes Stück entfernt“, bedauerte die Ministerin – tatsächlich nimmt nur rund jede zweite Frau zwischen 50 und 69 Jahren bisher an dem Programm teil.
Warken appellierte an die angeschriebenen Frauen: „Nutzen Sie die Chancen des Mammografie-Screenings.“ Zuletzt sind etwa 18.500 Frauen pro Jahr in Folge von Brustkrebs gestorben. Jeder vierte Todesfall könnte der Evaluation zufolge durch eine frühzeitige Diagnose vermieden werden.
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), in seinem Ressort liegt die Zuständigkeit für den Strahlenschutz, betonte die strenge Abwägung von Nutzen und Risiken mit Blick auf die Exposition durch Röntgenstrahlung. Die Teilnehmerinnen könnten sich darauf verlassen, dass der Nutzen größer ist. „Der Strahlenschutz in der Medizin ist in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau“, so Schneider.
Für die Kooperationsgemeinschaft Mammografie-Screening hob Thorsten Kolterjahn, Leiter der Geschäftsstelle, die konsequente Orientierung an den vorhandenen Guidelines als Merkmal der Umsetzung hervor.
Das weltweit größte bevölkerungsbezogene Screening-Programm mit etwa 14,5 Millionen anspruchsberechtigten Frauen sei zu Beginn nicht unumstritten gewesen, erinnerte er. „Die Kritik ist aber mit der Zeit immer leiser geworden.“ Die KBV ist gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband Träger der Kooperationsgemeinschaft.
Langer Vorlauf für die Evaluation
Professor André Karch vom Lehrstuhl für Klinische Epidemiologie an der Universität Münster, bei der die Federführung für die Evaluation lag, erinnerte an den langen Vorlauf: Seit 2010 wurde das Forschungsvorhaben in zwei Machbarkeitsstudien vorbereitet, ab 2018 begannen dann die beiden Hauptstudien. Dabei verfolgten die Wissenschaftler zwei parallele Untersuchungsansätze.
Zum einen wurden am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) in Bremen und beim SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen Daten der beteiligten Kassen (AOK Bremen/Bremerhaven, DAK, hkk, TK und Barmer) gesammelt und aufgearbeitet.
Zwei komplementäre Datenquellen verwendet
Zum anderen wurde ein bevölkerungsbasierter Ansatz gewählt – hier flossen in einer Vollerhebung die Daten aus dem Landeskrebsregister Nordrhein-Westfalen in die Untersuchung ein. Mit anspruchsvollen methodischen Verfahren wurde versucht, beispielsweise den „Healthy Screening Bias“ zu kompensieren. Gemeint ist der Effekt der Selbst-Selektion, dass mutmaßlich insbesondere Frauen mit hohem Gesundheitsbewusstsein das Screening wahrnehmen.
Durch die Nutzung komplementärer Datenquellen sei es gelungen, die Robustheit der Ergebnisse zu stärken, erläuterte Karch. Mit der Methodik, Kassendaten mit Informationen zur Todesursache aus Krebsregisterdaten zu kombinieren, sei die Evaluation eine Blaupause für die Bewertung weiterer Früherkennungsprogramme, betonte Professor Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer.
Zahlen zum Brustkrebs-Screening
- Von 1.000 Frauen, die 20 Jahre lang am Screening teilnehmen, können zwei bis sechs Frauen vor dem Brustkrebstod bewahrt werden.
- Von 1.000 Frauen, die sich im Mammografie-Screening untersuchen lassen,
- erhalten 970 Frauen einen unauffälligen und
- 30 einen auffälligen Befund,
- wird bei 11 Frauen zur Abklärung eine Biopsie vorgenommen,
- erhärtet sich bei 6 Frauen die Diagnose Brustkrebs.
- Jedes Jahr bekommen insgesamt rund 75.000 Frauen in Deutschland die Diagnose Brustkrebs gestellt.
Bei beiden Datenquellen zeige sich eine hohe Evidenz für eine Senkung der Brustkrebs-Sterblichkeit um 20 bis 30 Prozent. Das zeige, dass für Teilnehmerinnen an dem Programm jeder vierte Todesfall durch Brustkrebs verhindert werden könne, so Karch.
Die KBV bezeichnete die Ergebnisse als „ausgesprochen positiv und mehr als erfreulich“. „Wir haben es sehr begrüßt, dass die Altersgrenze am 1. Juli vergangenen Jahres auf 75 Jahre angehoben wurde“, betonen die Vorstände Dres. Andreas Gassen, Stephan Hofmeister und Sibylle Steiner. (fst)