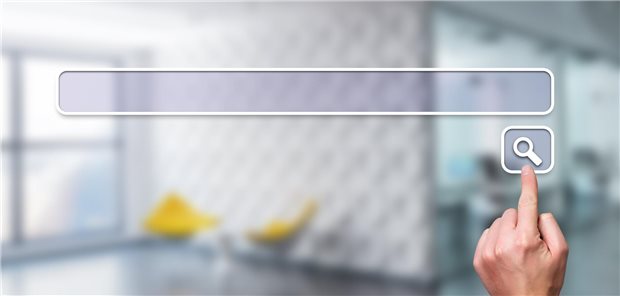Versorgung chronisch Kranker
Integrierte Patientenbetreuung in der EU: Schubmotor Coronavirus
Derzeit funktionieren EU-Gesundheitssysteme in der Akutbehandlung gut, bei chronischen Erkrankungen hapert es. Modelle zur ‚Integrierten Patientenbetreuung‘ sollen nun stärker gefördert werden.
Veröffentlicht:
Für die Nutzung der elektronischen Patientenakte sollte es künftig keine Grenzen in Europa mehr geben, forderten Politiker bei einer Pressekonferenz.
© Hero / stock.adobe.com
Brüssel. Ein Drittel der Menschen in der Europäischen Union (EU) lebt mit zwei oder mehr chronischen Krankheiten, wie Diabetes, Atemwegs- oder neuropsychiatrische Erkrankungen. Die jeweiligen Gesundheitssysteme haben sich dieser Tatsache allerdings noch nicht ausreichend angepasst: Sie sind zu fokussiert auf die Akutbehandlung, zu fragmentiert, zu krankenhausbasiert und nicht digital genug. Das hat die Expertengruppe für integrierte Betreuung und Digitale Gesundheit Europa (EGIDE) in einer Pressekonferenz kritisiert.
Die Fachleute fordern unter anderem bessere Allianzen zwischen Leistungserbringern wie Krankenhäusern, ambulanten Versorgungszentren, Primärärzten und langfristigen Betreuungsmodellen sowie der Pflege zu Hause, um eine wahrhaft ‚integrierte Patientenbetreuung‘ zu garantieren.
Aktenaustausch im Dreiländereck
Außerdem sollte die grenzüberschreitende Versorgung vereinfacht werden, erklärt der belgische EU-Abgeordnete Pascal Arimont: „Der Zugriff auf elektronische Patientenakten sollte nicht nur innerhalb eines Landes, sondern auch länderübergreifend zwischen Mitgliedstaaten möglich sein: So können sich Ärzte beispielsweise besser um einen ostbelgischen Patienten kümmern, dessen Hausarzt in Aachen sitzt, während die Spezialklinik im niederländischen Maastricht angesiedelt ist.“
Die Politik sollte die präventive, proaktive und koordinierte Behandlung chronisch kranker Patienten dementsprechend stärker unterstützen. Beispiele auf europäischer Ebene gibt es bereits, etwa das Scirocco Projekt oder die Vigour-Partnerschaft: Beide Programme zielen darauf ab, regionale Behörden bei der Entwicklung von Kapazitäten, beispielhaften Vorgehensweisen und der Digitalisierung der integrierten und interdisziplinären Betreuung von Patienten zu unterstützen.
Digitale Diabetesbetreuung
Unerwartete Unterstützung bei der Entwicklung integrativer Strukturen kam unerwarteterweise von der Corona-Pandemie, berichtete Bastian Hauck, Direktor der International Diabetes Federation Europa und selbst an Diabetes erkrankt. Hierbei habe nicht die große Politik dahintergestanden, sondern „es ist einfach passiert: Auf einmal waren E-Verschreibungen von Medikamenten via WhatsApp möglich, Ärzte und Krankenhäuser boten Arzttermine per Videokonferenzsystem an“, berichtete Hauck.
Wichtig sei es jetzt, nach dem hoffentlich baldigen Ende der Pandemie „nicht den Schwung zu verlieren“. Die Flexibilität, die in COVID-Zeiten gezeigt wurde, müsse in der Politik behalten und auf die Implementierung der integrierten Patientenversorgung übertragen werden. Hauck: „Unerlässlich ist der Fokus auf die Patienten: Diese Modelle sollten nicht für uns, sondern mit uns erstellt werden. Wir wissen, was zu tun ist – jetzt brauchen wir die Unterstützung von der Politik, auf Mikro-, Meso- und Makroebene.“ (luh)