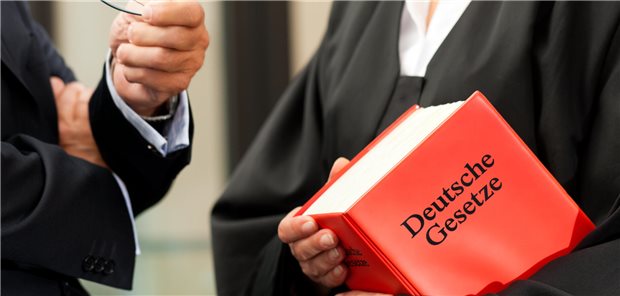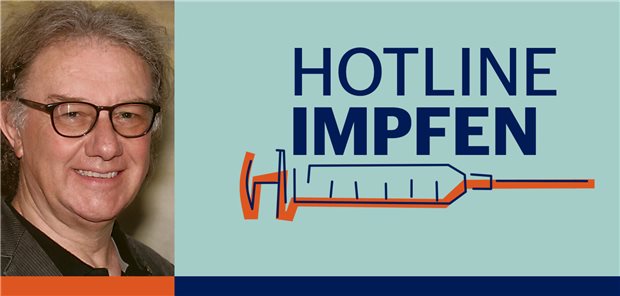Auswertung von KVB-Daten
Reizdarm-Risiko steigt auch nach leichteren Magen-Darm-Infekten
Gastrointestinale Infektionen sind offenbar unabhängig von Genese und Schweregrad mit einem erhöhten Risiko für ein Reizdarm-Syndrom assoziiert. Psychische Erkrankungen scheinen das Risiko zusätzlich zu steigern.
Veröffentlicht:
© absolutimages / Fotolia
MÜNCHEN. Hausärzte sollten bei Patienten, die die Praxis wegen einer Magen-Darm-Infektion aufgesucht haben, an mögliche postinfektiöse Folgen denken, empfehlen Ärzte der TU München und der Universität Tübingen (Gut 2017, online 10. Juni).
Das Risiko, ein Reizdarm-Syndrom zu entwickeln, ist ihren Untersuchungen zufolge selbst nach banalen Infekten deutlich erhöht. Besonders gefährdet sind demnach Darmpatienten mit einer psychischen Vorerkrankung.
Daten von 500.000 Patienten analysiert
Die Ärzte um Ewan Donnachie haben Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns aus den Jahren 2005 bis 2013 ausgewertet. 508.278 Patienten zwischen 18 und 60 Jahren mit der Erstdiagnose einer gastrointestinalen (GI) Infektion und ohne funktionelle Darmstörung wurden ebenso vielen nach Alter, Geschlecht und Wohnort passende Patienten ohne Magen-Darm-Infektion gegenübergestellt.
Die in der Analyse berücksichtigten GI-Infektionen waren mehrheitlich durch Viren verursacht (n = 305.697), an zweiter Stelle standen unspezifische Erkrankungen (n = 132.404), gefolgt von Infekten durch Bakterien (n = 50.381) und Protozoen (n = 9796). Häufiger als in der Kontrollgruppe waren bei den Infektpatienten psychische Erkrankungen in Form von Depressionen oder Angst- oder Stressreaktionsstörungen dokumentiert (22 vs. 17 Prozent).
Bei den Patienten mit GI-Infektion wurde unabhängig von deren Ursache während der folgenden fünf Jahre signifikant häufiger eine sichere Reizdarm-Diagnose (K58 oder F45.32) gestellt. Dabei variierte die Risikosteigerung gegenüber der Kontrollgruppe zwischen dem 2,2-Fachen bei viralen und dem 4,3-Fachen bei E.-coli-Infektionen. Bei unspezifischen Infekten war das Risiko um den Faktor 2,9 erhöht.
Eigenständige Risikofaktoren?
Eine psychische Vorerkrankung erwies sich ebenfalls als Risikofaktor für einen späteren Reizdarm. Das Risiko war um 70 Prozent höher als bei psychisch gesunden Versicherten. "Psychische Erkrankungen und GI-Infektionen scheinen eigenständige Risikofaktoren zu sein, die additiv zum Reizdarmrisiko beitragen", schreiben die Studienautoren. Außerdem erhielten Frauen doppelt so häufig wie Männer eine Reizdarmdiagnose.
Gastrointestinale Infektionen waren darüber hinaus auch mit einer Zunahme des chronischen Müdigkeitssyndroms assoziiert. Die Risikosteigerung fiel, je nach Infektionserreger, mit +40 bis +80 Prozent aber geringer aus als für den Reizdarm. Bei psychischen Vorerkrankungen war das Risiko verdoppelt.
In älteren Studien war die Entwicklung eines Reizdarms vor allem als Folge von Krankheitsausbrüchen und spezifischen bakteriellen, damit in der Regel schwerwiegenden gastrointestinalen Infektionen untersucht worden, so die Autoren. Ihre Daten zeigten, dass "Patienten mit nicht spezifizierten GI-Infektionen ein ähnlich hohes Risiko haben, danach eine Reizdarmdiagnose zu erhalten".
Dass psychisch Erkrankte unabhängig von einem GI-Infekt häufiger einen Reizdarm entwickeln, könnte den Ärzten zufolge mit der "Darm-Hirn-Achse" zusammenhängen: Neurologische Prozesse können zu Verdauungsstörungen führen und umgekehrt kann das Darmmikrobiom Prozesse im ZNS beeinflussen.