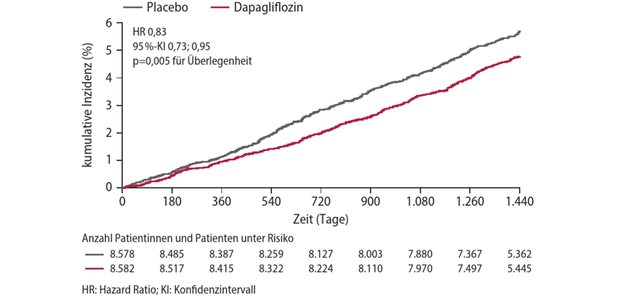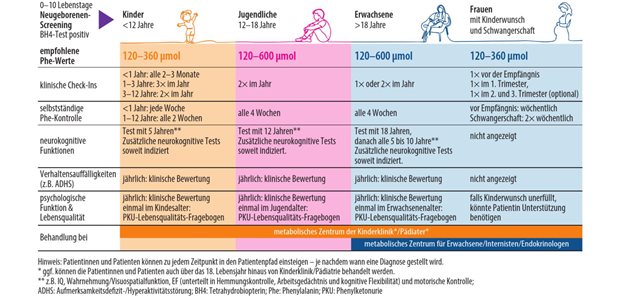Viele Ansätze bei funktioneller Dyspepsie
Etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung leiden an dyspeptischen Beschwerden. Meist steckt eine funktionelle Dyspepsie dahinter. Definitionsgemäß sind keine strukturellen Veränderungen nachweisbar. Finden lassen sich jedoch gastrointestinale Motilitätsstörungen und eine viszerale Hypersensitivität.
Veröffentlicht:
Epigastrische Schmerzen und Übelkeit - der Übergang zwischen funktioneller Dyspepsie oder Reflux ist häufig fließend.
© Foto: Gabriel Blajwww.fotolia.de
Epigastrische Schmerzen, Völlegefühl, Sodbrennen, Übelkeit oder Erbrechen - dieses Symptomenspektrum kann nicht nur auf eine funktionelle Dyspepsie (FD), sondern auch auf eine gastroösophageale Refluxerkrankung oder auf ein Reizdarmsyndrom hinweisen. Die funktionelle Dyspepsie ist somit - zumindest derzeit noch - eine Ausschlussdiagnose. Ändern könnte sich das mit Einsatz der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT). Professor Dipl.-Psych. Hubert Mönnikes von der Charité Berlin sieht in ihr eine Untersuchung, die eine Positivdiagnose der FD ermöglichen könnte (Der Gastroenterologe 6, 2008, 471).
Die fMRT ist eine nichtinvasive Messung der gastralen Akkommodation ohne Strahlenbelastung. In fMRT-Studien konnte bei über 60 Prozent der FD-Patienten eine Veränderung der Akkommodation oder Motilität festgestellt werden. Dabei handelte es sich zum Beispiel um eine isolierte Beschleunigung der initialen Magenentleerung oder um eine gestörte Relaxation in Kombination mit einer schnelleren Magenpassage.
Außer den veränderten gastrointestinalen Motilitätsstörungen findet sich bei Patienten mit FD zudem eine viszerale Hypersensitivität, so Mönnikes. Die Patienten empfinden im Vergleich zu Gesunden stärkere abdominale Beschwerden bei intragastralem Druckanstieg.
Die erste Maßnahme im Rahmen der Therapie bei FD ist es, den Patienten auf mögliche Triggerfaktoren zum Beispiel in Milchprodukten hinzuweisen. Eine Nikotinkarenz, gemäßigter Alkohol- und Koffeingenuss und die Vermeidung schwerbekömmlicher Nahrungsmittel können ebenfalls dabei helfen, die Symptome zu lindern. Reicht das nicht aus, kann in der FD-Therapie auf ein weites Spektrum von Medikamentengruppen und Wirkmechanismen zurückgegriffen werden. So ist zum Beispiel eine antisekretorische Therapie mit H2-Rezeptor-Antagonisten oder Protonenpumpenhemmern effektiv. Wobei in einer Metaanalyse vor allem Patienten mit ulzeröser oder refluxbedingter Dyspepsie profitierten. Auch eine H.-pylori-Eradikation brachte Vorteile.
Funktionelle Dyspepsie ist - derzeit noch - eine Ausschlussdiagnose.
Für Wirkstoffe, die die gastrointestinale Motilität positiv beeinflussen, konnte bei FD eine um 30 Prozent höhere Ansprechrate im Vergleich zu Placebo nachgewiesen werden. Zu diesen Prokinetika zählen zum Beispiel Metoclopramid, Domperidon, Trimebutin, Cisaprid, Itoprid und Mosaprid. Positive Effekte auf die gastrale Akkommodation konnten auch für Sumatriptan und Paroxetin nachgewiesen werden.
Auch pflanzliche Präparate werden bei Patienten mit FD häufig verwendet. Eine Metaanalyse von drei Studien mit mehr als 130 Patienten ergab zum Beispiel für STW5 (Iberogast®), das Auszüge aus neun verschiedenen Pflanzen enthält, einen positiven Einfluss auf die Magenfunktion. Das Präparat reduzierte die kontraktile Aktivität des Magenkorpus, während es die des Antrums steigerte.
Diagnostische Kriterien für funktionelle Dyspepsie
Die Kriterien müssen während der letzten 3 Monate vorhanden gewesen sein, ihr Beginn muss mindestens 6 Monate zurückliegen.
1. Die Diagnose umfasst eins oder mehrere der folgenden Symptome:
- störendes postprandiales Völlegefühl,
- frühe Sättigung,
- epigastrische Schmerzen und / oder
- epigastrisches Brennen 2. und zudem gibt es
- keinen Anhalt für strukturelle Erkrankungen (einschließlich obere Endoskopie), die die Symptome wahrscheinlich erklären können
Quelle: Der Gastroenterologe 5, 2008, 415
Lesen Sie dazu auch: Ständig Bauchschmerzen? Entspannen und Reden hilft


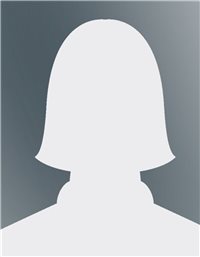






![Die Schilddrüse tickt in jedem Lebensalter anders Porträts: [M] Feldkamp; Luster | Hirn: grandeduc / stock.adobe.com](/Bilder/Portraets-M-Feldkamp-Luster-Hirn-grandeduc-stockadobecom-235723.jpg)