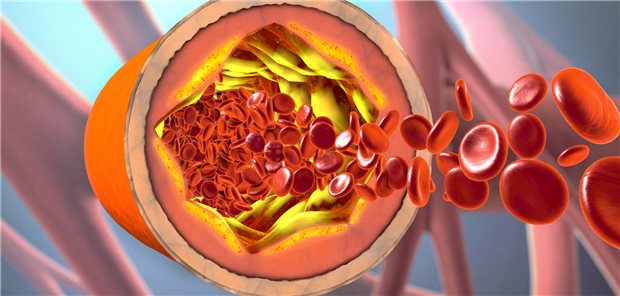DKK 2022
Krebskongress gestartet: Viele Schnittstellen, viel Handlungsbedarf
Molekulare Tests ermöglichen, sektorenübergreifend forschen, Präventionsmöglichkeiten besser nutzen: Die Krebsversorgung steht vor zahlreichen Herausforderungen – und viele davon erfordern bessere Kommunikation an Schnittstellen, heißt es zum Start des Deutschen Krebskongresses.
Veröffentlicht:
Fokussiert auf Schnittstellen in der Krebsmedizin: Professor Michael Ghadimi (Mitte), der Präsident des DKK 2022, bei der Auftakt-Pressekonferenz zum Kongress. Mit auf dem Podium (v. li.): DKG-Präsident Professor Thomas Seufferlein sowie Gerd Nettekoven, der Vorsitzende der Deutschen Krebshilfe.
© Peter-Paul Weiler, berlin-event-foto.de
Berlin. In Berlin ist am Sonntag, 13. November, der 35. Deutsche Krebskongress gestartet. Kongresspräsident Professor Michael Ghadimi von der Chirurgie am Universitätsklinikum Göttingen und sein Team haben für den DKK 2022 das Motto „Krebsmedizin: Schnittstellen zwischen Innovation und Versorgung“ gewählt. Denn an diesen Schnittstellen müsse vielfach gearbeitet werden, sagte Ghadimi bei der Auftaktpressekonferenz des Kongresses.
Betroffen ist nicht nur die klassische Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Versorgung beziehungsweise Rehabilitation. Auch bei interdisziplinären Schnittstellen, Stichwort Tumorboard, gebe es Optimierungsbedarf. Die Schnittstelle zwischen translationaler Forschung und klinischer Versorgung ist in Deutschland eine (endlose) Datenbaustelle.
An der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine entsteht spannende Innovation in Bereichen wie robotergeführte Chirurgie oder künstliche Intelligenz. Und die Schnittstelle zwischen Krebsversorgung und Politik ist bei der Prävention gefragt.
Baustelle Biomarker
DKG-Präsident Professor Thomas Seufferlein von der Inneren Medizin I am Universitätsklinikum Ulm ging auf einige der Schnittstellen-Themen, mit denen die Krebsversorgung zu kämpfen hat, genauer ein. So setzten viele personalisierte und innovative Therapiekonzepte eine molekulare Testung voraus, deren Finanzierung außerhalb von Leuchtturmprojekten oft noch nicht konsequent umgesetzt sei: „Es gibt wegweisende Initiative wie die Zentren für Personalisierte Medizin in Baden-Württemberg. Aber am Ende muss es bundesweit gehen.“
Schwierigkeiten gebe es nicht nur bei experimentellen Biomarkern, sondern auch bei schon etablierten Biomarkern für zugelassene Medikamente, insbesondere im stationären Bereich. Denn Biomarker-Bestimmungen seien nicht Teil der DRG, und entsprechend sei insbesondere die frühe Tumortestung derzeit oft lückenhaft.
Baustelle Forschung
Bei der Forschung müsse, Stichwort erneut Tumorbiomarker, dafür gesorgt werden, dass Daten aus den Tumorsequenzierungen Teil der Krebsregistrierung würden: „Hier fehlt ein klarer Ablauf. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um die molekulare Welt und die Welt der Krebsregistrierung zu verbinden.“ Diese Verbindung sei nicht zuletzt für die Qualitätssicherung in den Tumorzentren enorm wichtig.
Auch andere Datenquellen aus der onkologischen Versorgung müssten mit der Krebsregistrierung besser verzahnt werden, betonte der DKG-Präsident. Es gebe etliche leitlinienrelevante Fragestellungen, die sich nicht über randomisierte Studien, sondern nur über Daten aus der Versorgung beantworten ließen. Erleichtert werden könnte derartige Versorgungsforschung Seufferlein zufolge durch konsequenteres sektorenübergreifendes Arbeiten in der Krebsversorgung.
Dem schloss sich auch Gerd Nettekoven, Vorsitzender der Deutschen Krebshilfe, an: „Wir haben in den vergangenen 15 Jahren die nötigen Strukturen geschaffen. Jetzt wird es notwendig sein, dass Forschung und Versorgung mehr voneinander profitieren und enger interagieren.“
Baustelle Prävention
Ein wichtiger Aufruf an die Schnittstelle von Krebsversorgung und Politik geht in Richtung bessere Kommunikation von krebspräventiv wirksamen Maßnahmen. Das betrifft die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen, aber auch die von krebspräventiven Impfungen. So seien derzeit in Deutschland nur 52 Prozent der 18-jährigen Mädchen gegen HPV geimpft, und lediglich 2,5 Prozent der 18-jährigen Jungen.
„Damit sind wir Lichtjahre hinter Ländern wie Ruanda oder Botswana“, so Seufferlein. „Wir haben offensichtlich noch nicht den richtigen Weg gefunden, den Jugendlichen und Erziehungsberechtigten die Bedeutung dieser Impfung zu erklären.“
Bei den Vorsorgeuntersuchungen geht es zum einen um eine generell bessere Inanspruchnahme, vor allem aber auch um eine risikogruppenbezogene Weiterentwicklung. Beispiel Darmkrebsvorsorge: Hier mache es sehr viel Sinn, die Prävention und Früherkennung stärker in Richtung familiäre Risiken voranzuschieben, da bekannt sei, dass ein erheblicher teil der kolorektalen Karzinome eine familiäre Häufung zeige.