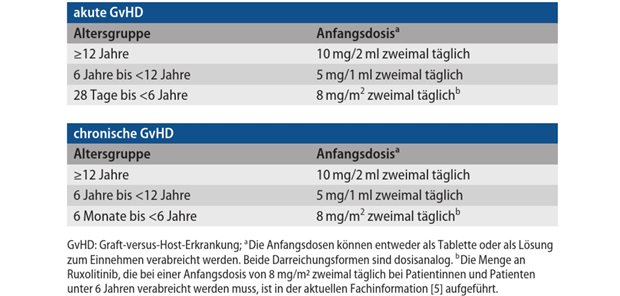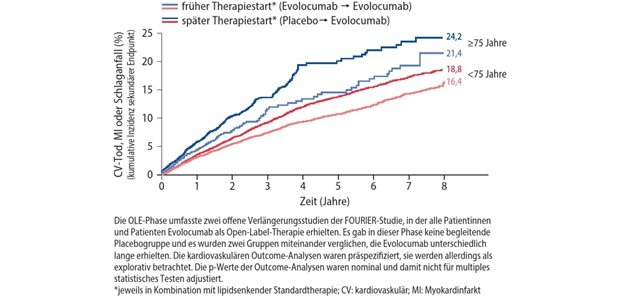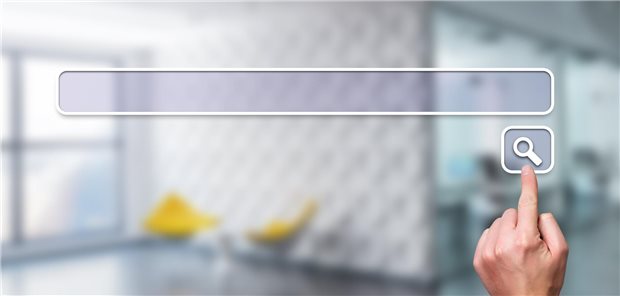Lebendnierenspende
Das höhere ESRD-Risiko ist geringer
Die absolute Risikozunahme ist zwar klein, aber signifikant: Nierenspender entwickeln häufiger als vergleichbare Nicht-Spender eine terminale Niereninsuffizienz. Doch ihr Lebenszeitrisiko ist immer noch geringer als das der Allgemeinbevölkerung - was an der Auswahl der Spender liegt.
Veröffentlicht:
Spenderniere: Lebendspender haben ein höheres ESRD-Risiko - verglichen mit vergleichbaren Menschen.
© horizont21 / fotolia.com
BALTIMORE. Dass Nierenspender nicht öfter dialysepflichtig werden als der Bevölkerungsdurchschnitt, ist schon in früheren Studien gezeigt worden. Der Vergleich verrät allerdings wenig über das Risiko, das durch die Spende eingegangen wird, da sorgfältig voruntersuchte Nierenspender per se ein geringeres Risiko für ein Nierenversagen haben als ein Durchschnittsbürger.
Ärzte der Johns Hopkins University in Baltimore haben deswegen die Erkrankungsraten von Nierenspendern mit der von Teilnehmern des Surveys NHANES III* verglichen, die potenziell als Spender infrage gekommen wären.
Von den 96.217 Personen, die zwischen 1994 und 2011 eine Niere gespendet hatten, entwickelten 99 in der Nachbeobachtungszeit von median 7,6 Jahren eine terminale Niereninsuffizienz (ESRD). Im Mittel trat die ESRD 8,6 Jahre nach der Spende auf.
Von 9634 vergleichbaren NHANES-III-Teilnehmern mussten 17 während des Follow-up von im Median 15 Jahren an die Dialyse, oder brauchten selbst ein Nierentransplantat.
Die daraus abgeleitete 15-Jahres-Rate für ein Nierenversagen betrug 30,8 pro 10.000 bei den Spendern und 3,9 pro 10.000 bei den Nicht-Spendern. Das höchste Risiko hatten mit 74,7 pro 10.000 Organspender afroamerikanischer Herkunft .
Bei weißen Spendern betrug die 15-Jahres-Quote nur 22,7 pro 10.000, gegenüber null pro 10.000 bei weißen Nicht-Spendern, dies war gleichzeitig der geringste absolute Risikoanstieg. Weiße Spenderinnen hatten sogar nur eine 15-Jahres-Inzidenz von 14,6 pro 10.000.
Das Lebenszeitrisiko von Spendern für ein terminales Nierenversagen schätzen die Studienautoren auf 90 pro 10.000. Die Vergleichszahl bei gesunden Nichtspendern beziffern sie auf 14 pro 10.000. Mit anderen Worten: Bei 76 Spendern von 10.000 Menschen, die für eine Spende in Frage kämen, stellt sich infolge der Nierenentnahme irgendwann ein terminales Nierenversagen ein.
Das Erkrankungsrisiko der Spender liegt damit nach Angaben der US-Forscher deutlich unter dem eines Durchschnittsbürgers, deren geschätztes Lebenszeitrisiko sie mit 326 pro 10.000 angeben.
Die Analyse bestätigt damit vorausgegangene Studien, denen zufolge das Risiko eines Nierenversagens bei Nierenspendern nicht höher ist als in der Allgemeinbevölkerung. Dennoch bringt die Organentnahme ein zusätzliches Risiko mit sich.
"Das Ausmaß der absoluten Risikozunahme ist jedoch klein", betonen die Studienautoren um Dr. Abimereki D. Muzaale. Die Zahlen seien eine wichtige Basis für das ärztliche Gespräch mit Menschen, die eine Lebendnierenspende erwägen. (bs)
*NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey