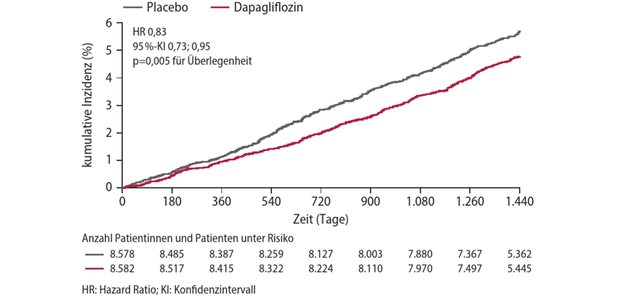Interdisziplinäre Versorgung
Diabetes und Lipödem: Warum dieses Paar besondere Aufmerksamkeit braucht
Mehr Aufmerksamkeit und eine interdisziplinäre Versorgung: Das fordert die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) für Betroffene mit Diabetes und Lipödem. Es braucht außerdem weitere Forschung, um Evidenzdefizite zu beheben.









![Die Schilddrüse tickt in jedem Lebensalter anders Porträts: [M] Feldkamp; Luster | Hirn: grandeduc / stock.adobe.com](/Bilder/Portraets-M-Feldkamp-Luster-Hirn-grandeduc-stockadobecom-235723.jpg)