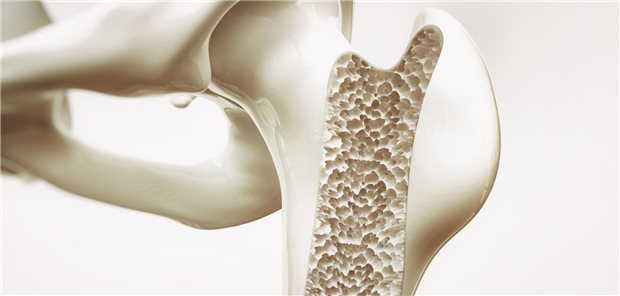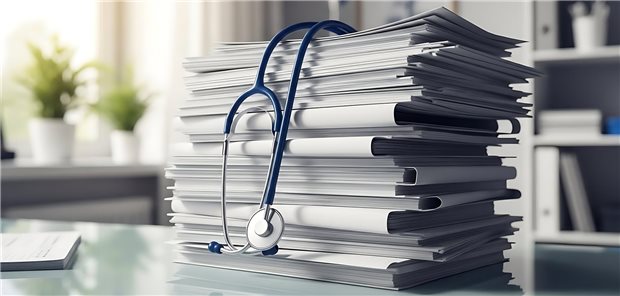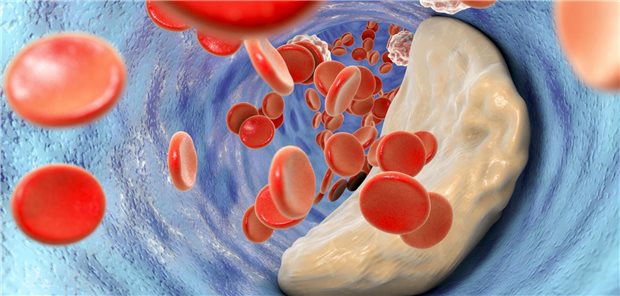Dopamin-Agonisten lassen Stammzellen im Gehirn wachsen
MARBURG (ner). Neue tierexperimentelle Studien und In-vitro-Versuche deuten darauf hin, daß Dopamin-Agonisten das Wachstum von Nervenzellen und Nervenendigungen fördern. Ein klinische Studie soll jetzt mit bildgebenden Verfahren klären, ob sich dieser Vorteil auch bei einer oralen Therapie mit den Arzneien feststellen läßt.
Veröffentlicht:Es gibt Hinweise darauf, daß Morbus Parkinson bereits zehn bis 15 Jahre vor dem Auftreten der ersten klinischen Symptome beginnt. Und zwar mit dem Tod von Nervenzellen im Bulbus olfactorius (Stadium I), der sich über den Hirnstamm (Stadium II) bis zur Substantia nigra (Stadium III) fortsetzt. Daran hat Professor Wolfgang Oertel aus Marburg erinnert. Mit neuroprotektiven Substanzen möchten Neurologen diese Prozesse aufhalten. Ob etwa Dopamin-Agonisten solche zellschützenden Eigenschaften haben, werde derzeit überprüft, sagte der Neurologe bei einer von Pfizer unterstützten Veranstaltung.
So hat die Marburger Arbeitsgruppe von Oertel gemeinsam mit französischen Forschern festgestellt, daß Dopamin-Agonisten, die in einem Parkinson-Tiermodell direkt in den Bereich der geschädigten Stammganglien injiziert wurden, dort die Zahl der neuronalen Stammzellen erhöhten. Das bedeute, daß Dopamin nicht nur für die Kommunikation zwischen Nervenzellen benötigt werde, sondern offenbar auch die Entwicklung von neuen Nervenzellen und Neuroglia fördere, so Oertel.
Für den Dopamin-Agonisten Cabergolin (Cabaseril®) ist kürzlich nachgewiesen worden, daß er den Wachstumsfaktor GDNF (glial cell derived nerve growth factor) induziert (Pharmacology 71, 2004, 162). GDNF verhindert den Untergang dopaminerger Zellen im Gehirn und führt zum erneuten Aussprossen dopaminerger Nervenendigungen, so Oertel.
In einer britischen Pilotstudie mit fünf schwerkranken Parkinson-Patienten sei es nach GDNF-Injektionen ins Putamen zu einer deutlichen Besserung der Symptome gekommen (wir berichteten). Die Ergebnisse einer größeren Studie mit GDNF werden in diesem Sommer erwartet.
Inzwischen können neuroprotektive Effekte durch spezielle bildgebende Verfahren direkt nachgewiesen werden. Mit Hilfe der Positronen-Emmissions-Tomographie (PET) werde etwa die Umwandlung von L-Dopa in Dopamin sowie die Speicherung von Dopamin in synaptischen Vesikeln dargestellt, mit SPECT (Einzelphotonen-Emmissions-Tomographie) der Dopamin-Transport.
In der jetzt anlaufenden europäischen AMADEUS-Studie wird mit diesen Verfahren geprüft, wie gut L-Dopa, Cabergolin oder Placebo die Degeneration dopaminerger Nerven bei Parkinson-Patienten im Frühstadium reduzieren können.