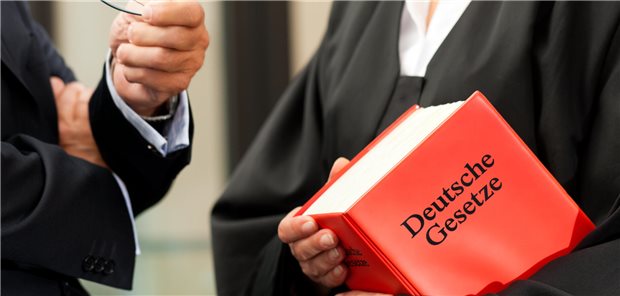Neuer Behandlungsansatz bei chronischen Wunden
Das Akute-Phase-Protein Alpha-1-Antichymotrypsin könnte sich bei chronischen Wunden eignen. Es gibt dazu erste Erfolge im Tiermodell zu vermelden.
Veröffentlicht:DRESDEN (sir). Das Proteom chronischer Wunden hat Professor Sabine A. Eming aus Köln genauer unter die Lupe genommen.
Beim Dermatologenkongress in Dresden präsentierte die Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten aktuelle Studiendaten, die auf eine neue Therapieoption für Patienten mit chronischen Wunden hinweisen könnten.
In Wundsekreten wurden verschiedene Proteine gefunden
25 Patienten mit venösen Ulzera waren in eine ihrer Studien eingeschlossen; bei zehn von ihnen waren die Wunden in Abheilung begriffen. "Wir fanden in den Wundsekreten aller Patienten insgesamt 149 verschiedene Proteine", berichtete Eming bei der Tagung in Dresden.
"23 von diesen Proteinen kamen nur in heilenden und 26 nur in nicht-heilenden Wunden vor", so die Expertin.
Die Expression und die Aktivität auch der übrigen 100 Moleküle habe sich deutlich in den beiden Studiengruppen unterschieden.
So fanden sich in den nicht-heilenden Wunden verstärkt Entzündungsmediatoren, in den heilenden dagegen Proteaseinhibitoren und Matrixproteine.
ACT wurde in allen Wunden gefunden
Besonders aufgefallen war den Forschern die Proteinfamilie der Serinproteaseinhibitoren, kurz Serpine, und hier wiederum Serpin A3, das auch Alpha-1-Antichymotrypsin (a1-ACT) heißt.
Das Akute-Phase-Protein wird in der Leber und, wie Eming herausgefunden hat, auch in Epithelzellen und inflammatorischen Zellen in der Haut synthetisiert. Hier hemmt es Cathepsin G und Mastzellchymase.
ACT wurde in allen Wunden, heilenden wie nicht-heilenden, gefunden. Bei der Mehrzahl der Patienten, das heißt bei 10 von 15, mit nicht-heilenden Wunden zeigte die Substanz jedoch praktisch keine Aktivität.
In einer In-Vitro-Versuchsanordnung ermittelte Eming die Neutrophilenelastase als Grund dafür: Diese Protease war im Infiltrat der nicht-heilenden Wunden erhöht und inaktivierte ACT.
Erfolg bei Mäusen
Als therapeutischen Ansatz haben Eming und ihre Kollegen nun im Tiermodell das Einbringen rekombinant hergestellter ACTs in das Wundmilieu getestet.
Mit Erfolg: Bei den so behandelten Mäusen bildete sich schon bald vaskularisiertes Granulationsgewebe.