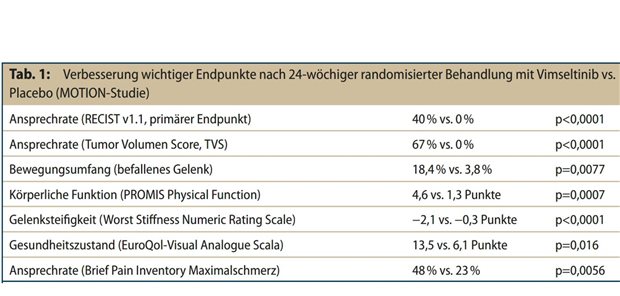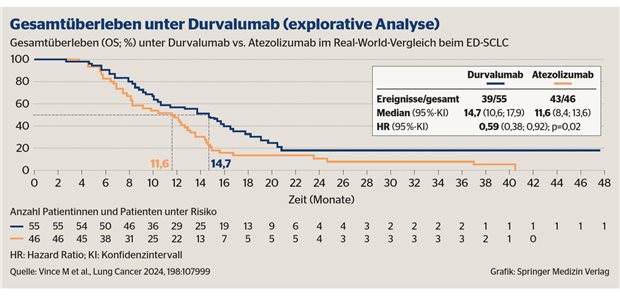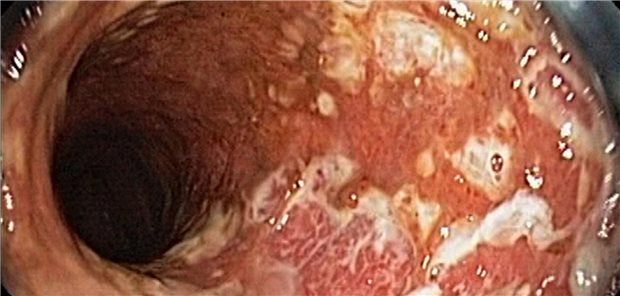Junge Krebsforscher beim DKK
Onkologische Forschung hat Nachwuchssorgen
Junge Krebsforscherinnen und Krebsforscher haben es schwer an deutschen Unis. Das könnte auf Dauer dazu führen, dass die Krebsforschung in Deutschland weniger konkurrenzfähig wird.
Veröffentlicht:
Forschung für Krebskranke ist durchaus vereinbar mit klinischer Tätigkeit und Familie. Förderprojekte ermöglichen dies.
© anyaivanova / Fotolia
Berlin. Wie kann gewährleistet werden, dass medizinische Innovationen möglichst rasch möglichst vielen Patienten mit Krebserkrankungen zugutekommen? Für den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekoven, ist das nicht nur eine Frage der Erstattung und auch nicht nur eine Frage der besseren Vernetzung von klinischer Versorgung und Forschung: „Wir brauchen auch gut ausgebildete wissenschaftliche Nachwuchskräfte, die sich für die Arbeit an der Schnittstelle von Labor und Patientenversorgung begeistern.“
Damit sehe es in Deutschland allerdings nicht besonders gut aus, so Nettekoven bei einer Pressekonferenz zum Start des Deutschen Krebskongresses (DKK) 2020 in Berlin. „Jungen Ärztinnen und Ärzten ist es kaum noch möglich, Facharztausbildung und Forschung in Einklang zu bringen. Ein Mangel an Nachwuchswissenschaftlern in der Krebsforschung ist absehbar, und damit läuft Deutschland Gefahr, international den Anschluss zu verlieren.“
Handlungsbedarf auf vielen Ebenen
Handlungsbedarf gibt es auf vielen Ebenen. So appellierte Professor Andreas Hochhaus, der Präsident des DKK 2020, an die Ärztekammern, mehr Flexibilität bei der Weiterbildung in der Onkologie zu ermöglichen. Zum einen müsse Laborforschung auf die Facharztweiterbildung besser anrechenbar werden.
Zum anderen sei es nicht zielführend, wenn in Universitäten kategorisch dieselben Weiterbildungskataloge genutzt würden wie an reinen Versorgungskrankenhäusern. Damit werde es den zusätzlich forschenden, universitären Nachwuchswissenschaftlern unnötig schwer gemacht.
Die Deutsche Krebshilfe versucht, mit neuartigen Förderprogrammen auf bessere Bedingungen für den Nachwuchs hinzuwirken. In Ergänzung zu personenbezogenen Fördermaßnahmen für Einzelwissenschaftler wurde vor anderthalb Jahren unter dem Titel „Mildred Scheel Nachwuchszentren“ ein Förderprogramm aus der Taufe gehoben, das darauf abzielt, medizinischen Fakultäten den Aufbau nachhaltiger Strukturen zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung zu ermöglichen.
Anschub für nötige strukturelle Veränderungen
Derzeit würden fünf derartige Nachwuchszentren mit je zehn Millionen Euro über fünf Jahre gefördert, so Nettekoven: „Die Resonanz auf dieses Programm lag weit über unseren Erwartungen. Von dreißig medizinischen Fakultäten haben 27 einen Förderantrag gestellt. Das macht deutlich, dass wir einen Nerv getroffen haben.“
Klar sei aber auch, dass die Förderung nur ein Anschub für die nötigen strukturellen Veränderungen sein könne: „Wir erwarten, dass Wissenschafts- und Gesundheitspolitik registrieren, was wir tun und ihrerseits dazu beitragen, Strukturverbesserungen wirklich flächendeckend zu erreichen.“
Kleine Kinder und Feierabendforschung – Geht das?
Dass die Mühe lohnt, betonte Dr. Cornelia Link-Rachner vom Zentrum für regenerative Therapien an der TU Dresden, einem der fünf Mildred Scheel Nachwuchszentren. Die Ärztin erforscht die Tumorimmunologie. Konkret analysiert sie T-Zell-Rezeptoren mit Next Generation Sequencing, um Hinweise darauf zu finden, wie sich schwere Graft-versus-Host-Reaktionen nach allogener Knochenmarkstransplantation besser vorhersagen lassen.
Link-Rachner wendet die Hälfte ihrer Zeit für die Laborforschung auf, die andere Hälfte für die klinische Tätigkeit – bei gleichzeitig klar geregelten Arbeitszeiten. Anders als andernorts sei das nicht nur Theorie, sondern werde dank des Förderprojekts und der dadurch angestoßenen Veränderungen auch wirklich so umgesetzt: „Förderprojekte wie dieses ermöglichen es, Forschung und Familie zu vereinbaren. Wer kleine Kinder hat, der kann keine Feierabendforschung mehr machen.“