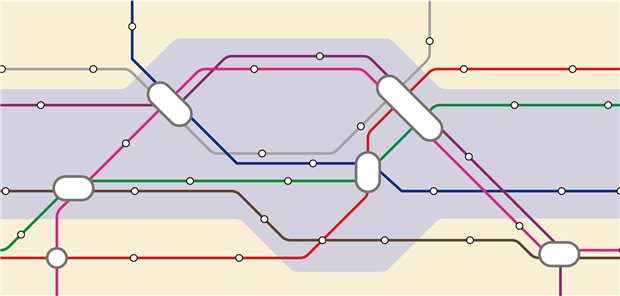Zäher Schleim
Risikofaktor für Asthma
Forscher haben einen grundlegenden Krankheitsmechanismus bei allergischem Asthma bronchiale und eine neue mögliche Behandlungsstrategie entdeckt.
Veröffentlicht:HEIDELBERG. Werden allergieauslösende Stoffe wie Partikel von Hausstaubmilben oder Schimmelpilzsporen eingeatmet, kann das vor allem dann zur Entwicklung eines allergischen Asthma führen, wenn die Selbstreinigungsfunktion der Atemwege durch zu trockenes Sekret beeinträchtigt ist.
Das haben Forscher des Zentrums für Translationale Lungenforschung Heidelberg jetzt im Tiermodell nachgewiesen (J Allergy Clin Immunol. 2016, online 16. November).
Studien an Mäusen, deren Bronchien aufgrund eines genetischen Defekts mit eher trockenem Schleim ausgekleidet sind, ergaben: Atmen diese Tiere Allergene ein, so entwickeln sie eine um ein Vielfaches stärkere allergische Atemwegsentzündung als Mäuse mit normal befeuchteten Atemwegen.
Sei das Sekret zu zäh, könne es von den Flimmerhärchen nicht mehr mitsamt der darin gebundenen Staubpartikel und Allergene aus der Lunge transportiert werden, heißt es in einer Mitteilung der Uni Heidelberg zur Veröffentlichung der Studie.
Würden die Allergene damit nicht ordnungsgemäß aus der Lunge abtransportiert, schütteten die Zellen der Atemwegsschleimhaut Botenstoffe wie Interleukin-13 aus und aktivierten damit bestimmte Immunzellen (T-Helferzellen Typ2). Die Entzündung kommt in Gang. "Das ist eine neue Erkenntnis: Die allergische Entzündung in der Lunge geht nicht auf eine primäre Fehlfunktion der Immunzellen zurück.
Diese reagieren vielmehr auf den Hilferuf der Schleimhautzellen. Solange die eingeatmeten Allergene effektiv aus der Lunge entfernt werden können, senden die Schleimhautzellen dieses Signal nicht aus. Dadurch fällt die Immunantwort trotz gleicher Belastung mit Allergenen deutlich geringer aus", erklärt Professor Marcus Mall, Direktor der Abteilung Translationale Pneumologie, in der Mitteilung.
Wurde die Befeuchtung des trockenen Schleims und damit der Abtransport der Allergene durch Inhalation mit dem Wirkstoff Amilorid verbessert, wurde in den Atemwegen nur noch wenig IL-13 freigesetzt und die allergische Atemwegsentzündung war deutlich reduziert.
Das sei eine neue kausale Therapiestrategie, die auch bei allergischem Asthma effektiv sein könnte, so Mall in der Mitteilung. Gängige Therapien linderten lediglich die Symptome: Sie lösen die verkrampfte Muskulatur der Bronchien und unterdrücken die Entzündung.
Daher könne diese neue Behandlungsstrategie einen wichtigen Fortschritt darstellen. Ob sie bei Patienten mit Asthma genauso effektiv ist wie im Tiermodell, müsse jedoch erst noch in klinischen Studien untersucht werden. (eb)