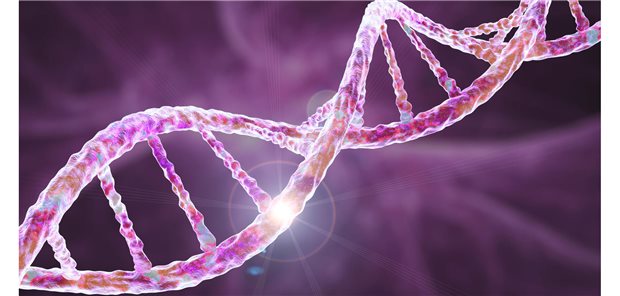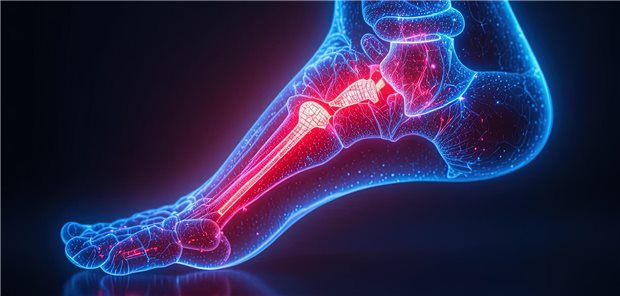Vorurteile
Suchterkrankungen: Stigmatisierung durch medizinisches Personal erschwert Therapie
Eine Frankfurter Studie zeigt: Vorurteile durch medizinisches Personal halten Menschen mit Suchterkrankungen von medizinischer Hilfe ab. Der Studienautor sagt, die Verantwortung für Veränderung liegt bei den Ärztinnen und Ärzten.
Veröffentlicht:
Haben Menschen mit Suchterkrankung körperliche Beschwerden, werden diese von Ärztinnen und Ärzten häufig bagatellisiert, ergab eine Studie aus Frankfurt.
© lassedesignen / stock.adobe.com
Frankfurt/Main. Stigmatisierung durch medizinisches Personal erschwert oder verhindert notwendige Behandlungen von Menschen mit Suchterkrankungen. Das zeigt eine Studie der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Frankfurt (Lancet Reg Health Eur 2026; online 12. Januar).
Viele Menschen mit Suchterkrankungen nehmen offenbar trotz gesundheitlicher Probleme keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Ein Forschungsteam um Dr. Mathias Luderer, Leitung Suchtmedizin, untersuchte gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Tübingen und der LMU München erstmals systematisch die Hintergründe, teilte die Universitätsmedizin Frankfurt am Montag (2. Februar) mit.
Die Mixed-Methods-Studie kombiniert quantitative Befragungen mit qualitativen Interviews. Es nahmen 119 Personen mit Suchterkrankung an der Studie teil. Die meisten von ihnen hatten eine Sucht nach Alkohol, Cannabis, Stimulanzien oder Sedativa.
Jeder Zweite verschweigt seinen Substanzkonsum
Aus Sorge vor Stigmatisierung verschwiegen der Studie zufolge fast 50 Prozent der 119 Befragten ihren Substanzkonsum. 36 Prozent vermieden medizinische Hilfe trotz akuter Erkrankung aus Angst vor einer schlechteren Therapie aufgrund ihrer Suchterkrankung. 29 Prozent gaben an, ein laufende Behandlung abgebrochen zu haben, weil sie die Erfahrung gemacht haben, aufgrund ihrer Sucht schlechter behandelt worden zu sein.
„Sie fühlen sich auf ihre Sucht reduziert, schämen sich und befürchten schlechte Erfahrungen – oft zu Recht“, wird Erstautor Dr. Mathias Luderer in der Mitteilung zitiert.
38 Studienteilnehmer gaben Beispiele für ihre Erfahrungen an. Besonders häufig schilderten sie, dass ihre Sucht in den Augen der Gesundheitsberufler ein moralisches Versagen sei und, dass ihre medizinischen Beschwerden als „nur (ein Symptom) der Sucht“ gedeutet werde. Auch gaben einige Personen an, dass sie nach Offenlegung ihrer Sucht einer direkten Feindseligkeit ausgesetzt seien.
Beispiele, von denen Betroffene berichten:
- Formulierungen wie: „Es ist deine eigene Schuld“ und „typisch für einen Alkoholiker“
- „Verachtung und abgrundtiefer Hass“ von Pflegerinnen und Pflegern
„Die eigene Einstellung überdenken“
Mehr Aufklärung, weniger Stigma: FASD richtig ansprechen
Zudem zeige die Studie, dass viele Betroffene die gesellschaftliche Abwertung von Suchterkrankungen verinnerlichen. Dieses sogenannte internalisierte Stigma erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Konsum verschweigen, medizinische Hilfe meiden oder begonnene Behandlungen abbrechen.
Ärzte müssen Haltung und Kommunikation neu definieren
„Die Verantwortung für Veränderung liegt bei uns, beim medizinischen Personal“, wird Luderer in der Mitteilung zitiert. „Wir müssen unsere Haltung und Kommunikation neu definieren, um die Versorgung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen zu verbessern.“ Luderer ist auch Drogen- und Suchtbeauftragter der Landesärztekammer Hessen und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG Sucht), die gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften ein Manifest zur Entstigmatisierung von Suchterkrankungen veröffentlicht hat. (eb)