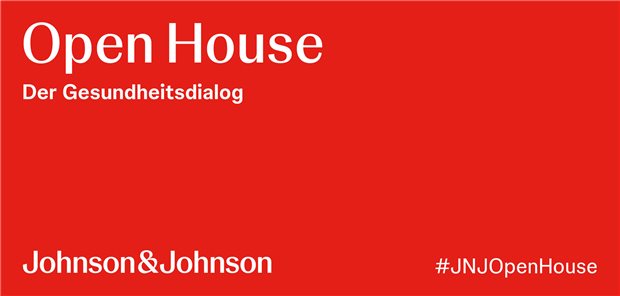Dank Kohlegeldern
Medizinische Fakultät für Cottbus?
Braunkohleregionen erhalten künftig Strukturfördermittel. In Cottbus soll daraus unter anderem eine Unimedizin geschaffen werden. Bis zu 1500 Nachwuchsmediziner sollen dort gerade auch für die Versorgung auf dem Land ausgebildet werden, sagt der Geschäftsführer und frühere Ärztliche Direktor des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus, Dr. Götz Brodermann, im Interview.
Veröffentlicht:
Am Carl-Thiem-Klinikum soll eine staatliche Unimedizin entstehen. Ein Schwerpunkt wird die digitale Medizin sein.
© Andreas Franke/picture alliance
Ärzte Zeitung: Herr Dr. Brodermann, was plant das Carl-Thiem-Klinikum mit den Strukturgeldern für den Braunkohleausstieg?
Dr. Götz Brodermann: Wir wollen ein Innovationszentrum Universitätsmedizin Cottbus werden, finanziert aus dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes für die Braunkohleregionen. Es soll eine staatliche Universitätsmedizin, eine Medizinerausbildung für voraussichtlich 1500 Studenten, nach Cottbus kommen.
Hat Cottbus, hat Ihre Klinik dafür die nötigen Kapazitäten?
Das Carl-Thiem-Klinikum ist ein klassischer Maximalversorger in kommunaler Hand. Das heißt, wir haben alle Fachdisziplinen an Bord, bis auf die Herzchirurgie. Die ist aber durch das Sana-Herzzentrum Cottbus hier auch auf dem Gelände vertreten. Insofern können wir prima vista erst einmal alles bedienen, was eine Universitätsmedizin an klinischen Fächern benötigt. Natürlich müssen wir die außerklinischen Fächer und Institute hier völlig neu ansiedeln.

Dr. Götz Brodermann, Ärztlicher Direktor des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus
© Carl-Thiem-Klinikum
Welcher Aufwand wäre damit verbunden?
Wir gehen im Moment davon aus, dass 650 Millionen Euro aus dem Strukturstärkungsgesetz für die Universitätsmedizin vorgesehen sind. Und wir gehen davon aus, dass eine Universitätsmedizin zusätzlich zu den bestehenden Arbeitsplätzen im Klinikum noch einmal 1500 bis 2000 direkte Arbeitsplätze und analog dazu noch einmal so viele indirekte Arbeitsplätze schafft.
Brandenburg hat seit der Wiedervereinigung auf die Gründung einer Universitätsmedizin verzichtet. Warum geschieht das jetzt? Weil plötzlich das Geld aus dem Kohleausstieg da ist?
Ohne die Strukturwandelgelder wäre die Gründung einer staatlichen Hochschule nicht möglich. Aber wir wissen alle: Wir haben in der Medizin in Deutschland in den letzten zehn Jahren nicht nach Bedarf ausgebildet. Wir haben unter Bedarf ausgebildet.
Wir haben einen Ärztemangel, nicht nur in den Kliniken, sondern auch und vor allem in der niedergelassenen Versorgung. Und dort speziell im ländlichen Bereich. Und ich denke, dass eine Universität auf dem Lande, also nicht in der Metropolenregion, auch dem Fachärztemangel in der Fläche entgegenwirken kann.
Worin unterscheidet sich Ihr Projekt von der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin?
Die MHB ist eine private Hochschule, von Kommunen getragen – aber privat und nicht staatlich. Wir werden staatlich getragen sein: Das heißt, es gibt einen Landes- beziehungsweise Bundeszuführungsbetrag, um die Forschung und Lehre zu finanzieren. Das müssen die Studenten an der MHB durch ihre Beiträge und externe Zuschüsse machen.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Was für ein Studiengang dann nach Cottbus kommt – ob es ein Modellstudiengang oder ein klassischer Studiengang wird – das steht im Moment noch nicht fest. Wobei ich eigentlich davon ausgehe, dass wir einen Modellstudiengang hier haben werden. Dort wollen wir insbesondere das Thema Digitalisierung in die Lehre und das Studium einbauen. Zumal es ja noch ein zweites Projekt aus dem Strukturwandel gibt, das uns betrifft – das „Smart Hospital“...
Was verbirgt sich dahinter?
Das Carl-Thiem-Klinikum soll zu einem digitalen Leitkrankenhaus ausgebaut werden. Wobei die Gelder für dieses Projekt auch in die Region fließen und neue Versorgungsmodelle schaffen, um auf die kommenden Herausforderungen zu reagieren. Denn wir werden künftig nicht so viele Ärzte in die Fläche bekommen, wie wir heute haben.
Das heißt: Wir brauchen eine andere Lösung für die Versorgung. Die Diagnostik kann zum Beispiel auch von einer Schwester Agnes gemacht werden, wenn sie digital vernetzt ist. Wir können über Videosprechstunden Angebote machen. Aber all das soll nun in ein integriertes Konzept, eben das „Smart Hospital“.
Noch einmal zurück zur MHB – planen Sie denn da eine Kooperation?
Das ist im Moment noch nicht klar. Gefühlt wird es, da wir beide in Brandenburg sind, auch eine Brandenburger Zusammenarbeit geben. Aber wie die aussehen wird, ist noch nicht geklärt. Wir müssen uns jetzt erst einmal auf uns selbst konzentrieren: Dass wir eine vernünftige Struktur hier herbekommen.
Wir brauchen ein gutes Konzept, um vor dem Wissenschaftsrat bestehen zu können. Und man muss auch sagen: Die Strukturwandelgelder, das sind Gelder für die Lausitz – und nicht für das komplette Land Brandenburg.
Wie lange würden die Gelder denn reichen?
Das kann man im Moment noch nicht absehen. Ich sagte ja bereits, dass ein Volumen von 650 Millionen Euro im Strukturfonds eingestellt ist. Und wir wissen, dass eine Universität für ihre medizinische Fakultät einen Zuführungsbeitrag von 50 bis 70 Millionen Euro pro Jahr braucht.
Was da vom Bund getragen werden kann und soll, und was da vom Land getragen werden kann und soll – das kann man im Moment wirklich noch nicht sagen.
Aber die 650 Millionen Euro würden sicher nicht mehr als zehn Jahre reichen...
Nein. Ganz realistisch: So lange kann man es nicht strecken.
Sie sprachen davon, eine Hochschule gründen zu wollen. In Cottbus gibt es ja schon die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). Warum eine eigene Hochschule und keine Fakultät dort?
Auch das ist noch nicht entschieden. Für die Medizinerausbildung braucht man eine Fakultät. Ob sie eigenständig wird, oder ein Teil der BTU, das wird durch das Land noch entschieden werden.
Was macht aus Ihrer Sicht denn Cottbus als Studienstandort attraktiv? Die BTU verzeichnet seit ihrer Gründung immer weniger Studierende. Wieso sollte da jemand nach Cottbus kommen?
Wir haben auf einen Medizinstudienplatz in Deutschland derzeit zehn Bewerber. Ich glaube deswegen nicht, dass wir ein Problem damit hätten, hier Studenten herzubekommen. Cottbus überzeugt sicherlich nicht auf den ersten Blick, von extern. Aber vielleicht auf den zweiten Blick, von intern.
Das sehen wir schon heute an unseren PJ-lern, wir sind ja Akademisches Lehrkrankenhaus der Berliner Charité. Wir haben in Cottbus ausgezeichnete Schulen, wir haben eine gute Infrastruktur und ein gutes Vereinswesen. Die Grundstruktur hier stimmt.
Was ist mit dem Rechtsextremismus in der Lausitz?
Durch den Verein „Zukunft Heimat“, der hier regelmäßig demonstriert, ist Cottbus in Verruf gekommen – dabei kommt der Verein gar nicht von hier, sondern demonstriert hier nur. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein rechtes Problem hier. Das ist völlig klar.
Dagegen kann man aber nur vorgehen, wenn man jeden Tag Flagge zeigt. Deswegen weht vor unserer Klinik unter anderem die Regenbogenfahne. Und deswegen betreiben wir auch Tag für Tag Aufklärung.
Aber schon heute haben ein Drittel unserer Ärzte ausländische Wurzeln. Sie haben sich in Cottbus integriert und fühlen sich hier wohl. Aber noch einmal zurück zur BTU...
Ja?
Ich glaube, die BTU hat im Rahmen der Fusion der Universität in Cottbus mit der Fachhochschule Lausitz in Senftenberg Studenten verloren. Im Rahmen des Strukturwandels soll der Standort BTU aber durch die Ansiedlung von außeruniversitären Instituten, wie dem Helmholtz-Institut, gestärkt werden. Wenn wir eine gute Anbindung mit der Infrastruktur, etwa durch eine ICE-Anbindung bekommen, dann werden wir auch attraktiver.
An der BTU gibt es ja schon einen sogenannten „Gesundheitscampus“. Wie arbeiten Sie damit zusammen?
Der Gesundheitscampus besteht im Moment aus Pflege- und Therapiewissenschaften. Mit denen kooperieren wir. Da gibt es eine enge Anbindung. Und wir werden auch künftig mit der Fakultät kooperieren. Aber diese Fakultät ist in Senftenberg und das Medizinstudium wird hier in Cottbus sein.
Aber es ist zum Beispiel auch geplant, einen Pharmazie-Studiengang nach Senftenberg zu bringen. Auch da wird es viele Anknüpfungspunkte geben. Was die Kooperation mit der BTU betrifft, setzen wir aber vor allem auf die klassischen Naturwissenschaften, zum Beispiel die Physiker.
Wo merkt man das denn bei Ihnen im Haus?
Wir haben im letzten Jahr eine Forschungs-GmbH gegründet: Die Thiem Research. Weil wir gesagt haben: Wir müssen jetzt versuchen, hier Forschungsprojekte herzubekommen. Da stellen wir schon heute gemeinsame Förderanträge etwa in der Informatik. Deswegen sind wir heute auch das erste außeruniversitäre Klinikum, das der Medizininformatik-Initiative beigetreten ist.
Diese Initiative wird vom BMBF gefördert und ist eine Initiative des Bundesgesundheitsministeriums. Dort sind bislang nur Universitätskliniken vernetzt. Wir haben ein Fördervolumen über 3,6 Millionen Euro für zwei Jahre bekommen. Das machen wir auch im engen Austausch mit der BTU zusammen.
Was bedeutet die Digitalisierung für Ihr Krankenhaus?
Das bedeutet, dass wir uns eigentlich neu denken müssen. Viele denken ja: Digitalisierung heißt, wir kaufen uns ein Computerprogramm, eine neue Software. Aber tatsächlich müssen wir unsere Prozesse neu denken. Digitalisierung wird dann sexy, wenn sie Arbeitsprozesse unterstützt und erleichtert. Zum Beispiel bei der Prozesssteuerung innerhalb des Klinikums.
Wir gehen etwa das Thema Ressourcensteuerung neu an: In einem Krankenhaus wie unserem muss in immer kürzerer Zeit immer mehr Diagnostik und Therapie angeboten werden. Und das wollen wir über EDV-Tools steuern, so dass alles stärker vernetzt ist, und auch der Patient mehr Transparenz erlebt.
Digitalisierung wird ja immer auch als Rettung für kleine Krankenhausstandorte angeführt. Welche Rolle kann da Ihre Klinik spielen?
Wir werden sicher in der Modellregion hier in der Lausitz die kleineren Standorte ans CTK anbinden. In kleinen Krankenhäusern haben sie oft nächtens keinen Radiologen mehr. Wir haben hier aber einen radiologischen Dienst. Das heißt, man kann ganz profan die kleinen Kliniken über eine teleradiologische Befundung unterstützen.
So wie wir heute schon über Laborkooperationen und alle Tertiärbereiche hinweg die kleineren Häuser unterstützen. Hier bei uns führen wir im Moment auch eine elektronische Patientenakte ein. Und genau diesen Einführungsprozess können wir auf ein kleines Haus dann 1:1 übertragen – und über die Medizininformatik-Initiative können wir uns so vernetzen, dass wir dann einen barrierefreien Zugang auf die Patientendaten haben, wenn ein Patient von einem kleinen Krankenhaus ins Große verlegt wird.
Zum Abschluss noch eine Frage, die nichts mehr mit der Fakultät zu tun hat, die man sich aber in Brandenburg und darüber hinaus durchaus stellt: Was haben Sie in der Corona-Pandemie eigentlich besser gemacht, als die Kollegen am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam? In Cottbus gab und gibt es ja so gut wie keine Fälle...
Zunächst mal muss man sagen: Wir haben Glück gehabt. Das ist das Erste. Wir hatten hier in Cottbus keine hohe Krankheitslast, anders als in Potsdam. Da war die Krankheitslast höher und damit auch das Einschleppungsrisiko.
Und: Wir haben eine leistungsfähige Mikrobiologie hier am CTK. Wir konnten von Anfang an selber auf Corona testen. Ohne Fremdlabor. Innerhalb von 24 Stunden haben wir unsere Ergebnisse gehabt. Am Anfang der Pandemie war es andernorts so, dass Sie bei peripheren Laboren bis zu 72 Stunden auf einen Befund gewartet haben. Sie sind drei Tage im Grunde „blind“ gewesen.
Diese Situation hatten wir so nicht. Das ist natürlich ein großer Vorteil: Wenn Sie nicht blind im Nebel herumsegeln, können Sie versuchen, zu steuern.
Also ein Plädoyer für die Labormedizin im eigenen Haus?
Ein Maximalversorger oder ein Universitätsklinikum muss die Laborversorgung selber machen. Das gilt für alle Sekundärbereiche: Radiologie, Pathologie, Labor und Mikrobiologie. Das gehört zur Kernkompetenz von großen Krankenhäusern. Und die haben wir hier in Cottbus.