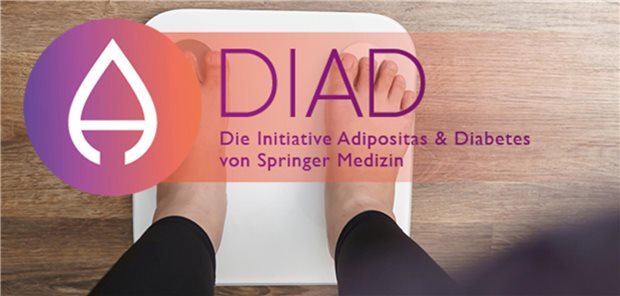Chancen für eine gezielte Behandlung bei sekundärer Osteoporose
Bei jungen Menschen und Männern mit raschem Knochenschwund lohnt die Suche nach einer sekundären Osteoporose.
Veröffentlicht:NEU-ISENBURG (ikr). Etwa jede fünfte osteoporosebedingte Fraktur ist auf eine sekundäre Krankheitsform zurückzuführen. Vor allem bei Jugendlichen, prämenopausalen Frauen, Männern und postmenopausalen Frauen mit rasch verlaufendem Knochenschwund ist eine rationelle Suche nach zugrunde liegenden Erkrankungen wie Laktoseintoleranz, Anorexia nervosa, Morbus Crohn, Hyperthyreose, COPD oder Hyperparathyreoidismus und nach knochenschädigenden Arzneien indiziert.
Eine frühe Diagnose lohnt sich: Das frühe Aufspüren der Grundkrankheit noch im Stadium einer präklinischen Osteoporose erlaubt mit den heutigen therapeutischen Möglichkeiten nicht nur eine Normalisierung von Knochenstruktur und Frakturrisiko, sondern auch eine gezielte Therapie oder gar Beseitigung des Osteoporose-Auslösers.
Darauf machen Professor Reiner Bartl vom Osteoporosezentrum in München und der Chirurg Dr. Christoph Bartl von der Uniklinik Ulm aufmerksam (Der Radiologe 2011; 4: 307).
Erste Hinweise durch körperliche Untersuchung
Erste Hinweise auf eine sekundäre Osteoporose kann man schon durch sorgfältige Befragung und eine körperliche Untersuchung erhalten, so die Experten. Kernstück der Diagnostik ist auch bei sekundärer Osteoporose die DXA-Messung im Zusammenspiel mit den vielfältigen bildgebenden Verfahren der Radiologie sowie den klinischen, laborchemischen und bioptischen Zusatzbefunden.
Gibt es aus der Anamnese Hinweise auf eine sekundäre Osteoporose, sind ergänzende Labortests obligat. Denn diese führen häufig zur initialen Diagnose der Grundkrankheit. Als laborchemisches Screening empfehlen die Experten: Blutkörperchensenkung (alternativ CRP), kleines Blutbild sowie die Serum-Bestimmungen von Kalzium und Phosphat, alkalische Phosphatase, Glukose, Transaminasen, Gamma-GT, und Kreatinin sowie die Messung der Vitamin-D-Metaboliten (25- und 1,25-Hydroxyvitamin D).
Bei entsprechender Indikation sollten weitere Tests erfolgen: T3, T4, TSH, Östrogen und/oder Testosteron, Parathormon, Elektrophorese und Immunelektrophorese. Außerdem: Tumormarker (PSA, CEA, CA15-3) und ein Differentialblutbild.