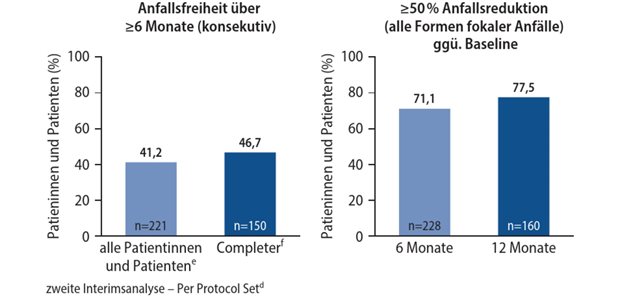Pharmakoresistenz bei Epilepsie neu definiert
Bei Verdacht auf eine pharmakoresistente Epilepsie sollten zunächst drei Dinge überprüft werden: die Compliance der Patienten, die Epilepsieklassifikation und die Diagnose selbst.
Veröffentlicht:
Trotz intensiver medikamentöser Therapie wird etwa ein Drittel aller Epilepsie-Patienten nicht anfallsfrei.
© imago / Koall
WIESBADEN. Epilepsie-Patienten haben nach einer neuen Definition dann eine pharmakoresistente Erkrankung, wenn zwei adäquate Therapieversuche gescheitert sind. Was adäquat ist, haben Experten in einem Konsensuspapier beschrieben.
Etwa ein Drittel aller Epilepsie-Patienten wird trotz intensiver medikamentöser Behandlung nicht anfallsfrei. An diesem Problem haben auch neue Antiepileptika nichts geändert, sagte Professor Bernard Steinhoff aus Kehl-Kork beim Neuro Update in Wiesbaden. Bei diesen Patienten sei die Epilepsiechirurgie die Behandlung der Wahl.
Man dürfe allerdings nur von Pharmakoresistenz reden, wenn die Art der Intervention angemessen war. Kriterien dafür sind im vergangenen Jahr in einem Konsensuspapier veröffentlicht worden (Epilepsie 2010, 51: 1069).
In der Praxis sei es leider oft schwer herauszubekommen, wie der jeweilige Patient in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten behandelt worden sei, sagte Steinhoff. Dass eine medikamentöse Mono- oder Kombinationstherapie gewirkt habe, könne man mit 85-prozentiger Sicherheit erst dann sagen, wenn ein Zeitraum beobachtet worden ist, der mindestens dreimal so lang ist wie das längste anfallsfreie Intervall zuvor. Mindestens jedoch muss der Patient zwölf Monate anfallsfrei gewesen sein.
Bei Kindern an Epilepsiechirurgie denken
Um beurteilen zu können, ob eine Therapie angemessen war, soll mindestens bekannt sein, welches Antikonvulsivum wie lange in welcher Formulierung und Dosis verabreicht worden ist. Sind Anfälle und unerwünschte Effekte aufgetreten? Wurde versucht, die Dosis zu optimieren? Zudem sollen die Gründe für einen Therapieabbruch eruiert werden.
Steinhoff riet, bei Verdacht auf eine pharmakoresistente Epilepsie zunächst die Compliance der Patienten, die Epilepsieklassifikation und die Diagnose zu überprüfen. Womöglich müsse ein richtig profiliertes Antiepileptikum unter Beachtung von Komorbiditäten und mit einem möglichst einfachen Therapieschema verordnet werden.
Prinzipiell sei es ratsam, bei pharmakoresistenten Patienten und bei Kindern frühzeitig an Epilepsiechirurgie zu denken.