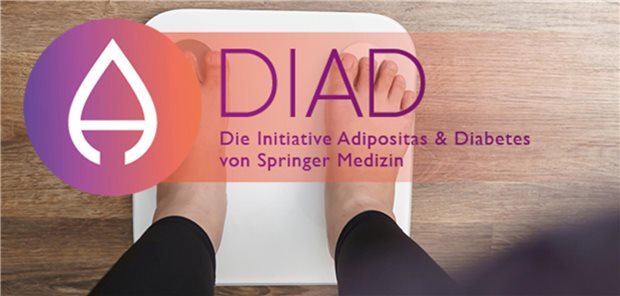Reduziert Magnesium das Diabetes-Risiko?
WIESBADEN (hbr). Eine Magnesiumzufuhr kann möglicherweise die Insulinresistenz und das Risiko für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes senken, so Professor Wolfgang Vierling von der TU München. Er empfiehlt, den Magnesiumspiegel regelmäßig zu messen.
Veröffentlicht:Auf den günstigen Einfluss des Mineralstoffs weist unter anderem die Analyse zweier großer Datensätze hin: der Nurses Health Study mit 85 000 Frauen und der Health Professionals Follow-Up Study mit knapp 43 000 Männern. Daten wurden während 18 und 12 Jahren erhoben. In dieser Zeit betrug die mittlere Magnesiumaufnahme bei den Frauen täglich 290 mg, mit einer Spanne von 79 bis 1110 mg. Die Versorgungslage der Männer war mit 102 bis 1593 mg pro Tag und einem Mittelwert von 349 mg etwas besser.
Die Auswertung ergab eine signifikant niedrigere Diabetesrate bei Teilnehmern mit hoher Magnesiumzufuhr: Die Rate war in der Quintile mit der höchsten Aufnahme um ein Drittel niedriger als in der Quintile mit der niedrigsten Zufuhr. "Das ist ein erheblicher Unterschied", betonte Vierling bei einem Symposium auf dem Internistenkongress in Wiesbaden. Der Unterschied betrug bei den Männern 33 Prozent und bei den Frauen 34 Prozent. Möglicherweise könne also Magnesiummangel die Diabetesentwicklung fördern.
Auch Patienten mit manifestem Typ-2-Diabetes und niedrigen Magnesiumspiegeln profitieren von einer Substitution. In Studien mit Patienten, die zusätzlich zu einer Sulfonylharnstoff-Therapie täglich 2,5 g Magnesium erhielten, verbesserte sich ihr HbA1c-Wert von 11,5 auf 8 Prozent. Ohne Magnesium sank er nur von 11,8 auf 10,1 Prozent. Gleichzeitig nahm die Insulinresistenz mit Magnesiumtherapie ab, ohne das Mineral aber zu.
Diabetiker können, ebenso wie Patienten mit Nierenerkrankungen oder Überfunktion der Schilddrüse, durch erhöhte renale Ausscheidung ein Defizit an Magnesium entwickeln. Weitere mögliche Ursachen sind zum Beispiel Diät und gastrointestinale Resorptionsstörungen. Aber auch Therapien mit Schleifendiuretika oder Digitalispräparaten können einen Mangel fördern - ein Problem, das vor allem viele alte Patienten betrifft, so Vierling.
Da Magnesium auch für die Kalzium-Homöostase und als Kofaktor vieler Enzyme erforderlich ist, sollte ein Mangel (unter 0,75 mmol/l im Serum) ausgeglichen werden, sagte Vierling. Die empfohlene tägliche Zufuhr beträgt für Frauen ab 25 Jahren 300 mg, für Männer 350 mg. Vor allem Nüsse und Vollkornprodukte sind gute Lieferanten des Mineralstoffs. Selbst Schokolade ist reich an dem Mineral - 100 g davon enthalten 86 mg Magnesium. Ziel ist auf jeden Fall ein Wert von mindestens 0,8 mmol/l.
Der Serumwert sollte bei 0,8 mmol/l liegen.