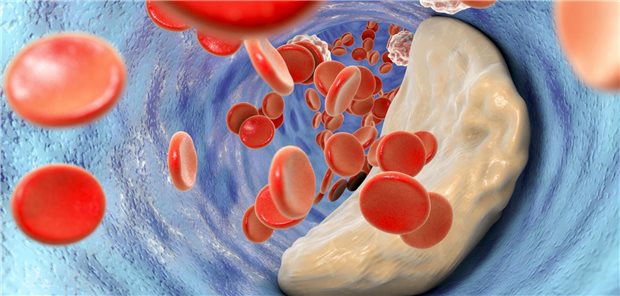Zink bessert Therapiechancen für Leberkranke
Patienten mit Hepatitis C, aber auch Patienten mit alkoholbedingten Leberschäden profitieren von Zusatztherapie mit Zink.
Veröffentlicht:
Die Leber ist ein wichtiges Organ für den Zinkstoffwechsel.
© Foto: sebastian kaulitzkiwww.fotolia.de
Patienten mit chronischer Hepatitis C oder hepatischer Enzephalopathie profitieren offenbar, wenn sie Zink einnehmen. So wird etwa die Ansprechrate auf eine Interferontherapie erhöht oder eine hepatische Fibrose gebremst.
"Die Leber ist das Hauptorgan des Zinkstoffwechsels", sagte Dr. Kurt Grüngreiff aus Magdeburg. Er hat den Zinkmangel als Co-Faktor in der Pathogenese der hepatischen Enzephalopathie (HE) schon vor etwa 20 Jahren ausgemacht. Vor kurzem wurde dieser Zusammenhang wissenschaftlich anerkannt. Die HE ist die wichtigste Komplikation der Leberzirrhose. Bei diesen Patienten gehört die Zinkgabe bei Zinkmangel zur Standardtherapie, so Grüngreiff. Das Spurenelement kann die hepatische Fibrose bremsen, die Regenerationsfähigkeit des Organs verbessern und den alkoholinduzierten oxidativen Stress in Leberzellen mindern.
Den Nutzen belegen Daten von 34 Patienten, die drei Monate lang ein Zinkpräparat zusammen mit Ornithinaspartat einnahmen. Bei etwa 60 Prozent der Patienten stieg der erniedrigte Zinkwert wieder. Die erhöhte Konzentration an Ammoniak - der wichtigste pathogenetische HE-Faktor - dagegen nahm ab und das HE-Stadium besserte sich. Grüngreiff plädierte dafür, bei Patienten mit Zinkmangel und Leberzirrhose auch ohne Vorliegen einer hepatischen Enzephalopathie Zink zu substituieren. Er gibt bei einem Serumspiegel unter 10 µmol/l täglich 15 mg und bei Werten unter 8 µmol/l die doppelte Menge. Eine Wertekontrolle erfolgt nach sechs bis acht Wochen.
Auch bei Patienten mit chronischer Hepatitis C erscheine die Therapie mit Zink in einer Mangelsituation sinnvoll. Dafür sprächen erste Ergebnisse einer japanischen Studie. Darin wurden 75 Patienten mit einer Interferontherapie oder mit Interferon (IF) plus Zinkgaben behandelt. Ein halbes Jahr nach Therapiestart wurde der Erfolg geprüft und ein klarer Unterschied festgestellt: 38 Prozent der Patienten, die IF plus Zink erhalten hatten, wiesen ein komplettes Ansprechen auf, waren also virusfrei. Ohne Zinkeinnahme dagegen war das nur bei elf Prozent der Fall.
Insgesamt wurde bei 56 Prozent der Patienten mit IF plus Zink ein komplettes oder zumindest teilweises Ansprechen notiert, aber lediglich bei 22 Prozent ohne Zink, so Grüngreiff beim internationalen Zinksymposium 2008 von Köhler Pharma. Das Unternehmen bietet etwa das Präparat Unizink® an. Möglicherweise greife Zink in die Replikation des Hepatitis-C-Virus ein, so Grüngreiff. Daten einer weiteren Studie weisen auf einen hemmenden Effekt hin.
Zinkmangel und Leber
Patienten mit Lebererkrankungen weisen häufig ein Zinkdefizit auf. 30 bis 50 Prozent der Alkoholiker leiden zum Beispiel darunter. Die Ursachen für den Zinkmangel liegen in einer erhöhten renalen Ausscheidung und einer verminderten Aufnahme, etwa durch alkoholbedingte Resorptionsstörungen oder zu niedrige Zufuhr. Bei dekompensierter Leberzirrhose besteht in 80 Prozent der Fälle ein Defizit. Die Folgen des Zinkmangels bei Leberkranken reichen vom Verlust der Körperbehaarung über trockene Haut und Appetitmangel bis zu gestörter Wundheilung und zerebraler Dysfunktion. Daneben kann Zinkmangel bei Leberzirrhose wegen der verringerten Vitamin-A-Mobilisierung zu Nachtblindheit führen.
(hbr)