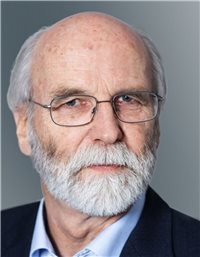Hintergrund
COPD: Mit Morphin gegen schwere Atemnot?
Morphin kann bei COPD-Kranken mit schwerer Dyspnoe die Symptome lindern, wenn andere Mittel nicht helfen.
Veröffentlicht:
Künftig können COPD- Patienten mit therapieresistenter Atemnot Opoide bekommen.
© www.digitalstock.de
Welchen Stellenwert sollte Morphin für COPD-Patienten mit therapierefraktärer Atemnot haben? In einer kleinen kanadischen Studie waren die Patienten froh über die Linderung durch das Opioid. Künftig werde es daher nicht mehr darum gehen, ob, sondern wie und wann Opioide diesen Patienten zur Verfügung gestellt werden sollten. Das meinen die Studienautoren um Dr. Graeme Rocker von der Dalhousie University in Halifax (CMAJ 2012; online 23. April).
Die Anwendung von Opioiden zur Therapie von Patienten, die eine schwere COPD mit therapierefraktärer Dyspnoe haben, wird meist restriktiv gehandhabt. In der Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin heißt es dazu: "Der Einsatz von Morphin kann bei schwerer Dyspnoe zur Linderung beitragen. Wegen bedeutsamer unerwünschter Effekte (unter anderem Atemdepression) sollte der Einsatz auf wenige besonders beeinträchtigte Patienten mit schwerer Atemnot und Hyperventilation beschränkt und unter stationären Bedingungen eingeleitet werden."
Opioidtherapie von drei Seiten untersucht
Kanadische Ärzte haben diese Therapieoption in einer kleinen Untersuchung nun von drei Seiten aus beleuchtet, nämlich aus der Sicht von Patienten (n = 8), von pflegenden Familienangehörigen (n = 12) und von behandelnden Ärzten (n = 28).
Zum Zeitpunkt der Befragung erhielten drei Patienten 0,5 bis 2 mg Morphinsulfat mit sofortiger Wirkstofffreisetzung, und zwar viermal pro Tag. Vier Patienten erhielten zweimal pro Tag 20 bis 30 mg eines retardierten Opioids (sustained release) mit zusätzlich einem schnell freisetzenden Morphinpräparat bei Exazerbation der Dyspnoe. Ein Patient nahm sublinguales Fentanyl. Die Patienten waren zwischen 52 und 79 Jahre alt.
Alle Patienten gaben an, dass sich durch die Opioidtherapie ihre Lebensqualität signifikant verbesserte oder die Atemnot linderte oder beides zusammen - ein klares Argument für die Weiterbehandlung mit Opioiden. "Man ist danach viel entspannter und muss nicht mehr so um Luft kämpfen", so einer der Patienten.
Auch pflegende Angehörige empfanden Therapie hilfreich
Auch die meisten der pflegenden Angehörigen empfanden die Opioidtherapie als sehr hilfreich. Die Patienten würden dadurch normaler atmen. Bei vielen Patienten würden zudem durch die Behandlung Symptome von Angst und Depression gelindert. Unerwünschte Wirkungen der Therapie seien kaum ein Problem.
Nicht zuletzt sie selbst profitierten von der Opioidtherapie der Patienten, weil sie dadurch weniger Stress ausgesetzt seien, so die meisten Angehörigen.
Viele der befragten Ärzte waren bisher nicht mit den Optionen für COPD-Patienten im fortgeschrittenen Stadium und mit schwerer Atemnot zufrieden und daran interessiert, mehr über neue Therapiemöglichkeiten zu erfahren. In der Klinik Opioide zu verschreiben und zu verabreichen war für sie weniger das Problem.
Die meisten fühlten sich jedoch nicht wohl bei dem Gedanken, die Medikamente für die Anwendung zu Hause oder in Pflegeheimen zu verordnen.
Mögliche Atemdepression bereitet Ärzten Sorgen
Vielen der teilnehmenden Ärzte machte der Gedanke an die Atemdepression als mögliche unerwünschte Wirkung der Opioidtherapie Sorgen. Gerade Ältere gaben etwa an, dass ihnen in der Ausbildung eingetrichtert wurde, Opioide den COPD-Patienten mit Dyspnoe nicht zu geben, weil dies Atemdepression auslöse.
Gerade bei alten und gebrechlichen Patienten werde leicht überdosiert, wenn Ärzte den Umgang mit Opioiden nicht gewohnt seien, so einer der befragten Ärzte.
Nach Ansicht der Studienärzte gibt es mehr und mehr Erfahrung mit dieser Medikation bei Dyspnoe im Zusammenhang mit einer COPD. Schon bald werde es selbstverständlich sein, solche Patienten, denen kein anderes Medikament helfen kann, mit Opioiden palliativmedizinisch zu behandeln. Es gehe dann nur noch um die Frage, wie sich das kompetent umsetzen lasse.