Dyspnoe
COPD mit Herzkrankheit wird häufig verkannt
Komorbiditäten sind bei COPD häufig. Besonders denjenigen aus dem kardiovaskulären Bereich dürfte eine besondere Bedeutung zukommen, erläutern unsere beiden Gastautoren.
Veröffentlicht: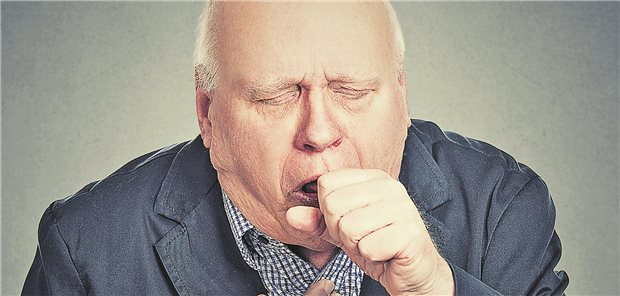
Jeder fünfte Studienteilnehmer mit stabiler COPD hatte eine kardiovaskuläre Erkrankung. (Symbolbild mit Fotomodell)
© pathdoc / stock.adobe.com
Das Leitsymptom, die Dyspnoe, in Ruhe oder unter Belastung, dürfte bei der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) häufig zunächst der Lungenerkrankung allein zugeordnet werden, und ein kardialer Anteil bleibt nicht selten unerkannt. Deswegen wurden Daten der COSYCONET-Kohorte hinsichtlich des kardialen Beitrags zu Symptomen bei COPD untersucht (Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019; 14:2163-2172).
Hierbei handelt es sich um eine multizentrische Langzeituntersuchung von Patienten mit stabiler COPD, und es wurden neben dem klinischen Status und der Vorgeschichte der Teilnehmer deren Lungenfunktionsuntersuchungen, Ganzkörperplethysmographien, ihre kardiovaskuläre Medikation und echokardiographische Untersuchungen analysiert. Als Maß für die Symptome der 1591 untersuchten Studienteilnehmer mit COPD wurden die klinisch etablierten Fragebögen mMRC (modified Medical Research Council), der SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire) und der CAT™ (COPD Assessment Test) verwendet.
Daten der COSYCONET-Kohorte
Kardiovaskuläre Komorbiditäten hinsichtlich des Vorliegens einer KHK, eines in der Vorgeschichte stattgehabten Myokardinfarktes oder einer bekannten Herzinsuffizienz fanden sich bei 18 %. Mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer hatte wenigstens ein kardiovaskuläres Medikament, z.B. Betablocker, ACE-Hemmer, Angiotensinrezeptorantagonisten oder Diuretika (einschl. Aldosteronantagonisten). Eine echokardiographisch reduzierte linksventrikuläre Funktion oder Dilatation fand sich bei ca. 13 %. Innerhalb dieser Gruppe war cirka einem Drittel der Teilnehmer das Vorliegen einer kardiovaskulären Erkrankung nicht bekannt, und sie hatten keine dementsprechende Medikation.
Umgekehrt hatte die Mehrzahl der Patienten mit einer kardiovaskulären Medikation eine normale echokardiographische Herzfunktion, was nahelegt, dass andere Indikationen für die in der Regel unspezifische Therapie mit den zuvor genannten Substanzen vorlagen. Dies dürfte in erster Linie die häufige arterielle Hypertonie sein. Daher wurden im nächsten Schritt der Analyse Patienten mit einer isolierten Hypertonie, d. h. ohne weitere kardiovaskuläre Erkrankungen, ausgeschlossen und die verbleibenden weiter untersucht. Unter diesen Patienten fanden sich viele mit reduzierter linksventrikulärer Auswurffraktion oder Dilatation, die keine adäquate Herzinsuffizienztherapie erhielten.
Strukturgleichungsmodell erstellt
Für detailliertere Analysen der Zusammenhänge zwischen Lungenfunktionsparametern der Obstruktion, bodyplethysmographischen Messungen der Überblähung, der kardiovaskulären Vorgeschichte und Medikation, der kardialen Funktion und Morphologie sowie von Belastungssymptomen wurde ein Strukturgleichungsmodell (SEM) erstellt. Es zeigte sich, dass die Belastungssymptome am besten im mMRC und in der Aktivitätskomponente des SGRQ angezeigt werden. Neben den Einflüssen der Lungenfunktionseinschränkung fand sich auch eine direkte Beziehung von der Herzgröße auf die Dyspnoe.
Zusammenfassend fanden sich bei dieser großen Kohorte mit stabiler COPD bei ca. einem Fünftel der Teilnehmer kardiovaskuläre Erkrankungen. Bei einem bemerkenswerten Anteil an Patienten mit auffälligen Echokardiographie-Befunden waren jedoch kardiovaskuläre Erkrankungen nicht bekannt und dementsprechend auch nicht behandelt. Dies dürfte mit einem erhöhten Risiko und einer Prognoseverschlechterung einhergehen.
Eine wesentliche Ursache hierfür dürfte sein, dass die von Patienten geschilderte Dyspnoe bei bekannter COPD häufig nur der pulmonalen Erkrankung zugeordnet wird und wichtige Differentialdiagnosen außer Acht bleiben. Hier sollte das Bewusstsein für die hohe Prävalenz kardiovaskulärer Erkrankungen bei COPD geschärft und häufiger die Durchführung kardialer Untersuchungen in Betracht gezogen werden, um eine adäquate Therapie einleiten zu können.
Professor Peter Alter ist als Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin der Philipps-Universität Marburg tätig.
Privatdozent Dr. Rudolf A. Jörres ist Leiter der AG „Experimentelle Umweltmedizin“ an der LMU München.







