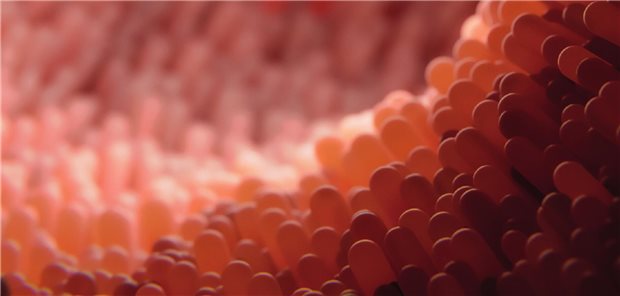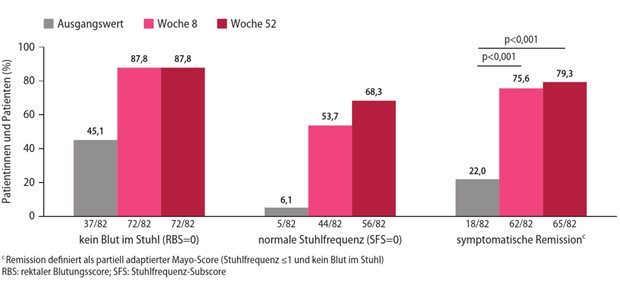Blutgefäße im Blick
Was ein Transkriptionsfaktor mit Leberfibrose zu tun hat
GATA4: Der Verlust dieses Transkriptionsfaktors im Endothel der Lebersinusoide reicht aus, um eine Leberfibrose zu verursachen. Das legen Studien des Uniklinikums Mannheim nahe.
Veröffentlicht:
Die Leber als Forschungsgegenstand: Wissenschaftler aus Mannheim haben dabei besonders die Lebersinusoide und den Transkriptionsfaktor GATA4 im Blick.
© Visual Generation / stock.adobe.com
Mannheim. Inwiefern Blutgefäße bei der Entstehung der Leberfibrose von Bedeutung sind, haben Forscher der Universitätsmedizin Mannheim untersucht (Journal of Hepatology 2020; online 9. September). In vorangegangenen Arbeiten hatten die Forscher bereits zeigen können, dass der Transkriptionsfaktor GATA4 wichtig für die korrekte Entwicklung dieser Blutgefäße sei, erinnert die Uni Heidelberg in einer Mitteilung zur Veröffentlichung der Studie.
Transkriptionsfaktoren erkennen bestimmte DNA-Strukturen, binden daran und regulieren so, ob von einem Genabschnitt die Information für ein neues Protein abgelesen wird oder nicht. Den Lebersinusoiden, den kleinsten und hoch spezialisierten Blutgefäßen der Leber, widmete sich das Forscherteam um Professor Dr. Sergij Goerdt, Privatdozent Dr. Philipp Reiners-Koch und Professor Cyrill Géraud besonders.
Angiokrine Faktoren begünstigen Leberfibrose
In der aktuell veröffentlichen Arbeit hätten die Wissenschaftler belegt, dass der Verlust von GATA4 in dem die Lebersinusoide auskleidenden Endothel ausreicht, um eine Leberfibrose zu verursachen, was mit einer gestörten Funktion und Regenerationsfähigkeit des gesamten Organs einhergehe, teilt die Uni mit.
Außerdem hätten sie nachgewiesen, dass spezielle, von Blutgefäßen abgegebene Botenstoffe, sogenannte angiokrine Faktoren, die Fibrose der Leber vermitteln. Dazu gehört zum Beispiel der Wachstumsfaktor PDGFB (Platelet-derived growth facor B). Und auch ein Großteil der Genexpression in den Blutgefäßen der Leber sei verändert. Dadurch ändere sich Struktur und Funktion der Lebersinusoide, sodass diese zunehmend Blutgefäßen ähneln, wie sie in anderen Organen, etwa der Lunge, zu finden sind.
Die vorliegende Arbeit trage zu einem besseren Verständnis der Krankheitsprozesse bei der Leberfibrose bei. „Dass Funktionsstörungen der Blutgefäße der Leber direkt zu einer gestörten Funktion des gesamten Organs führen, bestätigt, dass die Blutgefäße die Organfunktion – und damit auch Krankheitsprozesse – kontrollieren können“, wird Reiners-Koch in der Mitteilung der Uni zitiert. „Darüber hinaus ist mit der Achse GATA4/PDGFB ein potenzieller neuer Angriffspunkt für eine mögliche Therapie identifiziert worden“, so Erstautor Dr. Manuel Winkler. (eb)