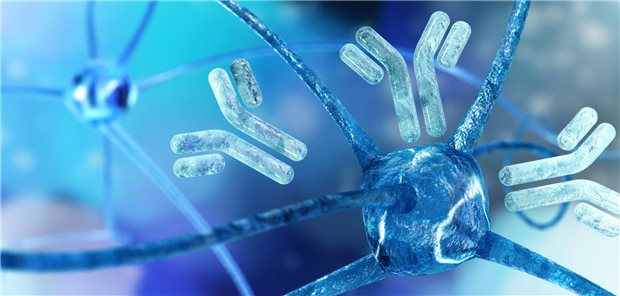Daten von Millionen Menschen ausgewertet
Demenz-Risiko: Auch leichter Alkoholkonsum ist vermutlich schädlich
Begünstigt Alkohol eine Demenz oder hat ein moderater Konsum sogar eine neuroprotektive Wirkung? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Eine aktuelle Untersuchung bringt Licht ins Dunkel.
Veröffentlicht:
An der Frage, ob es ein „gesundes Maß“ an Alkohol gibt und moderater Alkoholkonsum sogar neuroprotektiv wirken könnte, scheiden sich die Geister. Eine aktuelle Untersuchung ging ihr auf den Grund.
© exclusive-design / stock.adobe.com
Oxford. Ein britisch-amerikanisches Forscherteam hat mit einem multimodalen Methodenansatz den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Demenz untersucht. Genetische Analysen ergaben, dass das Demenz-Risiko mit zunehmendem Alkoholkonsum linear ansteigt (BMJ Evid Based Med 2025; online 23. September).
Für ihre großangelegte Studie kombinierten die Forscher zwei methodische Ansätze:
- eine rein phänotypische Beobachtungsstudie und
- Genanalysen auf Basis genomweiter Assoziationsstudien (GWAS)
Dazu griffen sie auf zwei große Kohorten zurück: das Million Veteran Programme (MVP) und die UK Biobank (UKB). Mehr als 500.000 Erwachsene wurden in die Beobachtungsanalysen einbezogen und durchschnittlich vier Jahre (US-Kohorte) beziehungsweise zwölf Jahre (britische Kohorte) nachbeobachtet.
Der Alkoholkonsum wurde anhand von Fragebögen und des klinischen Screening-Instruments Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C) ermittelt.
Alkohol – gut oder schlecht für die Kognition?
- Während die gesundheitsschädlichen Wirkungen von Alkohol in vielen Bereichen evident sind, bleibt ein kausaler Zusammenhang mit Demenz umstritten.
- Einige Forschungsergebnisse deuten auf eine neuroprotektive Wirkung von moderatem Alkoholkonsum hin.
- Darauf basiert die Vermutung, dass die Auswirkungen von Alkohol auf das Gehirn nicht linear sind und es eine „optimale Dosis“ für die kognitive Gesundheit geben könnte.
- Jüngste Neuroimaging-Studien haben dagegen selbst bei geringem Alkoholkonsum negative Zusammenhänge mit Demenz aufgedeckt.
- Randomisierte kontrollierte Studien zu Alkoholkonsum und Demenz-Risiko verbieten sich aus praktischen und ethischen Gründen, was die Erforschung des Zusammenhangs erschwert.
Die genetischen Analysen basierten auf zusammenfassenden Daten aus mehreren großen GWAS zu Demenz mit insgesamt 2,4 Millionen Teilnehmenden. Dabei wurden drei genetische Messgrößen im Zusammenhang mit Alkoholkonsum als Expositionen verwendet, um die Auswirkungen des Alkoholkonsums auf das Demenz-Risiko zu untersuchen:
- der selbst angegebene wöchentliche Alkoholkonsum
- problematischer Alkoholkonsum
- Alkoholabhängigkeit
Genanalysen: kein Hinweis auf schützende Wirkung von Alkohol
Die Beobachtungsanalysen ergaben wie schon frühere Forschungsergebnisse einen U-förmigen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Demenz-Risiko, das heißt, das geringste Demenz-Risiko hatten leichte bis mäßige Trinker.
Im Vergleich zu leichten Trinkern (weniger als sieben Getränke pro Woche) wurde bei Nichttrinkern und starken Trinkern, die 40 oder mehr Getränke pro Woche konsumierten, ein um 41 Prozent höheres Risiko, bei Alkoholabhängigen ein um 51 Prozent höheres Risiko beobachtet.
Die genetischen Analysen zeigten dagegen ein anderes Bild. Hier stieg das Demenz-Risiko mit einem genetisch vorhergesagten höheren Alkoholkonsum stetig an, und zwar für alle drei Expositionsstufen.
Zum Beispiel war ein Anstieg von einem auf drei alkoholische Getränke pro Woche mit einem um 15 Prozent erhöhten Demenz-Risiko verbunden und eine Verdopplung des genetischen Risikos für eine Alkoholabhängigkeit mit einem 16-prozentigen Risikoanstieg.
„Optimale Alkoholdosis“ beruht wohl auf umgekehrter Kausalität
Wieso dann aber die beobachtete Schutzwirkung von moderatem Alkoholkonsum? Den Studienautoren zufolge könnte dies eine Folge umgekehrter Kausalität sein. Denn sie fanden auch heraus, dass diejenigen, die später an Demenz erkrankten, in den Jahren vor ihrer Diagnose in der Regel weniger Alkohol konsumierten.
Der allmähliche kognitive Rückgang führte also zu einem geringeren Alkoholkonsum – und nicht umgekehrt Alkohol zu Demenz. So ließe sich die vermeintlich schützende Wirkung von geringen Alkoholmengen erklären.
Das Fazit der Autoren: „Die Ergebnisse unserer Studie stützen die Annahme, dass sich jeglicher Alkoholkonsum nachteilig auf das Demenz-Risiko auswirkt, und legen nahe, dass die Reduzierung des Alkoholkonsums eine wichtige Strategie zur Demenzprävention sein kann.“