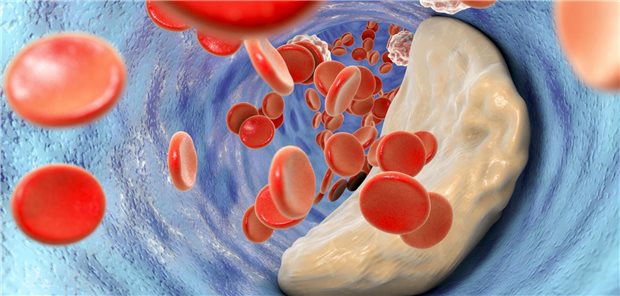Bei den Genen kommt es auf die richtige Verpackung an
BERLIN. Methylgruppen können Gene gewissermaßen stummschalten. Was das für die Entstehung oder den Verlauf von Krankheiten bedeutet, wollen Epigenetiker herausfinden. Sie haben deswegen das "Humane Epigenomprojekt" ins Leben gerufen und hoffen auf neue Diagnostika und darauf, bei Krebs die Genaktivität therapeutisch beeinflussen zu können.
Veröffentlicht:Können 30 000 Gene wirklich alles sein, was dem Zellkern zum Thema Menschwerdung einfällt? Die noch überschaubare Zunft der Epigenetiker zweifelt stark daran und weist seit Jahren darauf hin, daß Chromosomen mehr sind als eine Abfolge von Basen.
Gene sind eingebettet in Eiweiße von größtenteils unklarer Funktion. Und sie können chemisch verändert werden, etwa indem Methylgruppen aus einem Kohlenstoff- und drei Wasserstoffatomen an eine Base, nämlich an Cytosin, angelagert werden. Schätzungsweise vier Prozent des Erbguts von Menschen sind mit Methylgruppen markiert.
Methylgruppen schalten bei Frauen ein X-Chromosom ab
"Die Methylierung ist eine Langzeitvariante der Genregulation", erläutert Professor Bernhard Horsthemke vom Institut für Humangenetik der Universität Essen der "Ärzte Zeitung". Anders als die kurzfristige Steuerung der Gentätigkeit durch Signaleiweiße blockierten Methylgruppen die Aktivität eines Gens oder auch ganzer DNA-Stränge langfristig, so Horsthemke. Wenn etwa bei Frauen in allen Zellen das zweite X-Chromosom lebenslang genetisch abgeschaltet wird, dann sind dafür Methylgruppen zuständig.
"Wer vor zehn Jahren das Wort Epigenetik in den Mund nahm, der wurde in die Nähe der Parapsychologie gerückt", erinnert sich Horsthemke schmunzelnd. Er hat gut lachen, koordiniert er doch heute den vor zwei Jahren eingerichteten Sonderforschungsbereich Epigenetik der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
In der Tat war die Epigenetik lange umgeben von einer Aura des diffus Romantischen, sind doch Methylierungen vererbbar und dennoch abhängig von äußeren Einflüssen. Die Vererbung erworbener Eigenschaften aber war im 19. Jahrhundert eines der Lieblingskinder vieler Biologen. Und Zufall oder nicht, aber im Moment haben die Deutschen international eine Führungsposition in der epigenetischen Forschung inne.
Doch jenseits aller Ideengeschichte ist die Epigenetik heute längst ein wichtiges Teilgebiet der Genforschung geworden, wo Fragen geklärt werden sollen, auf die die klassische Genetik nicht so ohne weiteres Antworten liefern kann. In Analogie zum Humangenomprojekt wurde jetzt sogar das - überwiegend privat finanzierte - "Humane Epigenom-Projekt" ins Leben gerufen. Das Ziel: In den nächsten Jahren sollen systematisch die Methylierungsmuster von zehn Geweben entschlüsselt werden, um so eine genetische Methylierungskarte des menschlichen Körpers zu erhalten.
Doch nicht nur in unterschiedlichen Geweben variieren die Methylgruppenmuster. Man weiß mittlerweile, daß sich auch bei Krebs die gewebetypische Methylierung der Erbsubstanz verändert. "Unsere Arbeitsgruppe konnte zum Beispiel zeigen, daß die krebshemmende Funktion von Tumorsuppressorgenen bei bestimmten Formen des Retinoblastoms durch fehlerhafte Methylierungen beeinträchtigt wird und nicht wie sonst durch Mutationen", so Horsthemke.
Solche tumorspezifischen Methylierungen lassen sich künftig vielleicht diagnostisch nutzen. So berichten Innsbrucker Forscher über erfolgversprechende Versuche mit der Bestimmung des Methylierungsmusters von Erbsubstanz in Stuhlproben als Marker zur Früherkennung von Dickdarmkarzinomen (Lancet 363, 2004, 1283).
Doch die Epigenetiker träumen auch von neuen Therapien: Wenn der Methylierungszustand bei der Zellteilung, etwa im Tumor, an Tochterzellen weitergegeben wird, dann sind daran bestimmte Enzyme beteiligt, die Erhaltungsmethylasen. Sie kann man medikamentös hemmen in der Hoffnung, daß das pathologisch stillgelegte Gen dadurch wieder anspringt und den Tumor so zurückdrängt. "In Zellkulturen geht das", berichtet Horsthemke, "aber im Moment sind die Hemmstoffe, die wir haben, für einen Einsatz bei Menschen noch zu unspezifisch".
So arbeiten Epigenetiker
Die Basensequenz eines Abschnitts der DNA zu ermitteln, ist heute Routine. Doch um herauszubekommen, wo genau an diesem DNA-Abschnitt Methylgruppen angelagert sind, müssen sich Forscher eines Tricks bedienen: Sie versetzen die Erbsubstanz mit bestimmten Schwefelverbindungen. Diese Bisulfite verwandeln die Base Cytosin, die Zielstruktur aller DNA-Methylierungen, in die Base Uracil, aber nur dann, wenn am Cytosin keine Methylgruppe hängt. Auf diese Weise werden Unterschiede in der Methylierung in Sequenzunterschiede "umgeschrieben", die dann mit herkömmlichen Sequenzierungsmethoden analysiert werden können. (gvg)