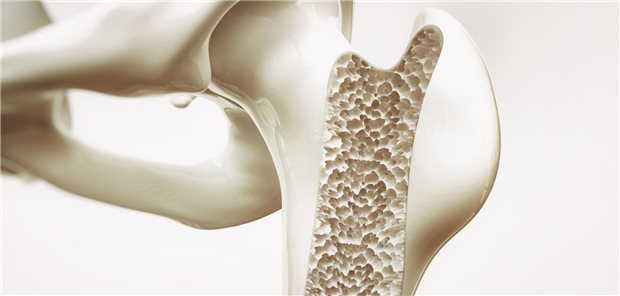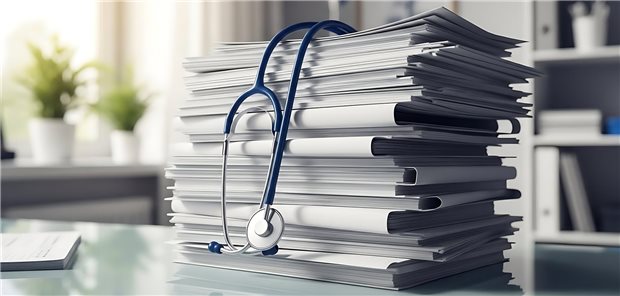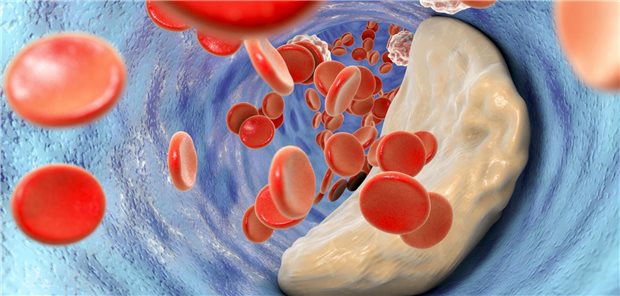"Alles ist wie im Spitzensport - auch Doping"
GÖTTINGEN (cben). Der Göttinger Orthopäde Professor Wolfgang Schultz ist eines Tages unerwartet in den Spitzensport aufgestiegen - als Mannschaftsarzt der deutschen Leichathleten im Behindertensport. Bei der Leichtathletik-WM der Behinderten in Assen in Holland betreut er derzeit seine Schützlinge.
Veröffentlicht:Dabei muß sich Schultz bis Sonntag um etwa 70 deutsche Sportler kümmern. Die Athleten vergleichen ihre Leistungen getrennt nach der Schwere und Art ihrer Behinderung. Die behinderten Spitzensportler stürmen die 100 Meter in 11,68 Sekunden, stoßen die Kugel weit über sieben Meter, und Athletinnen schleudern den Diskus auf fast 40 Meter.
15 Stunden am Tag begleitet Schultz die Leichtathleten zu den Wettkämpfen, repariert Prothesen, legt Tape-Verbände an, lindert Wehwehchen und schlimmere Schmerzen, "vor allem Muskelansatzschmerzen, die sich durch das Tragen der Prothesen ergeben".
"Schwere Verletzungen wie Brüche sind selten"
Auch wenn sich die Behindertensportler weit häufiger verletzen als die nicht behinderten, sind doch "schwere Verletzungen wie Brüche sehr selten". Im Wettkampf sei der Physiotherapeut beinahe wichtiger als der Arzt, meint Schultz.
Die meiste Arbeit geschehe zwischen den Wettkämpfen. Schultz hat sein ärztliches Camp in einem Container zwischen den Stadien aufgeschlagen, der zugleich Apotheke und Praxis ist. Auch begleitet er die Sportler zur Dopingkontrolle. "Alles ist wie überall im Spitzensport", sagt der Orthopäde von der Universitätsklinik Göttingen.
In der Tat gebe es ebenso großen Ehrgeiz und leider auch das Doping-Problem. Im Prinzip gelten wie überall die Regeln der World Anti Doping Agency (WADA) und der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA). "Aber auf Antrag erhalten die medikamentenpflichtigen Sportler natürlich ihre speziellen Präparate", sagt Schultz und ergänzt: "Ehrgeizige Sportler nehmen eben auch Verbotenes."
Erstmals war Schultz bei den paralympischen Spielen in Atlanta 1996 am Start. Seither betreut er die Sportler zusammen mit zwei Kollegen in den Trainingslagern und während der Großveranstaltungen. Behindertensport hält er für eine "gesellschaftliche Aufgabe". Aber begeistert sei er besonders von der persönlichen Beziehung zu den Sportlern, die sich über die Jahre aufgebaut haben.
Der ständige Kontakt hat enge Bindungen wachsen lassen
Der ständige Kontakt zu den Sportlern habe über die Jahre enge Bindungen wachsen lassen. "Da freut man sich vielmehr mit, wenn einer unserer Sportler eine Medaille gewinnt, als bei nicht behinderten Athleten", berichtet der Arzt.