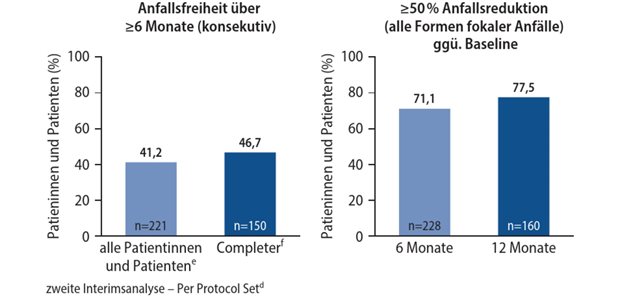Tsunami gegen Subarachnoidalblutung
Patienten mit Subarachnoidalblutung (SAB) entwickeln oft nach etwa einer Woche großflächige ischämische Schlaganfälle. Der Grund könnten elektrische Riesenwellen sein, die sich unter Umständen als therapeutischer Angriffspunkt eignen.
Veröffentlicht: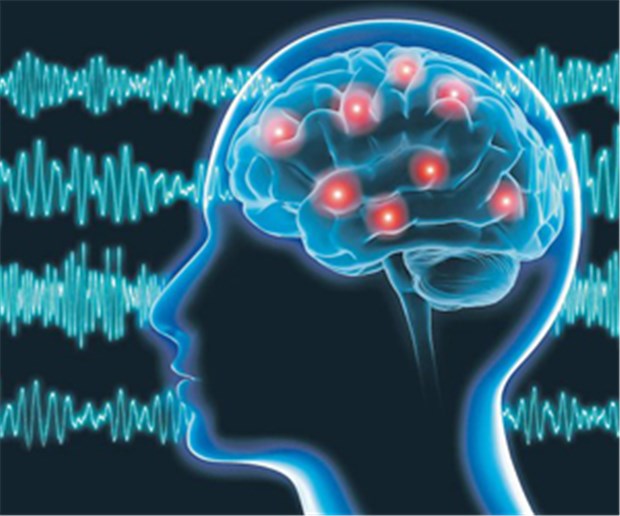
Elektrische Riesenwellen stehen im Verdacht, im Gefolge einer SAB Schlaganfälle auszulösen.
© psdesign1/fotolia.com
BERLIN. Der verzögerte Schlaganfall im Gefolge einer SAB sei ein wesentlicher Grund für die hohe Mortalität und Morbidität bei diesen Patienten, sagte Professor Jens Dreier von der Klinik für Neurologie der Charité Berlin.
Drei von zehn SAB-Patienten sterben, genauso viele tragen dauerhafte Behinderungen davon.
Zusammen mit Kollegen anderer Universitäten hat Dreier in den letzten Jahren geklärt, was dem verzögerten Schlaganfall bei der SAB wahrscheinlich zugrunde liegt.
Durch den Zerfall roter Blutkörperchen kommt es zu einem Überangebot an Kalium, das der Ausgangspunkt für eine Depolarisationswelle ist, die sich über die Hirnrinde ausbreitet. Dieser "Tsunami" aktiviert die Nervenzellen.
Der Nährstoffbedarf steigt. Doch das Gehirn kann darauf nicht mit einer Weitstellung der Blutgefäße reagieren, weil gleichzeitig das zerfallende Hämoglobin vasodilatativ wirksame Moleküle wie Stickstoffmonoxid abpuffert. Die Folge ist ein ischämischer Schlaganfall ohne thrombotischen Gefäßverschluss.
Möglicher Ansatz für präventiven Eingriff
"Was wir noch nicht genau wissen ist, warum bei manchen Patienten diese Katastrophe passiert, bei anderen dagegen nicht", sagte Dreier bei einer Veranstaltung des Centrums für Schlaganfallforschung Berlin (CSB).
In der internationalen DISCHARGE-1-Studie wird jetzt ein Algorithmus entwickelt, der anhand von Messungen der elektrischen Wellen auf der Hirnrinde die Vorhersage erlaubt, welchen SAB-Patienten ein verzögerter Schlaganfall droht.
Gemessen wird mit Hilfe einer Bandelektrode auf der Hirnoberfläche. Das ist deswegen relativ unproblematisch, weil viele SAB-Patienten ohnehin einen invasiven Eingriff an der Schädelkalotte benötigen.
"Wenn wir die Patienten mit erhöhtem Schlaganfallrisiko identifizieren könnten, dann könnten wir sie unter Umständen auch präventiv behandeln", sagte Dreier. Wie das gehen könnte, ist freilich noch nicht ganz klar.
Diskutiert werden Sedativa, die die Ausbreitung der Erregung möglicherweise bremsen. Auch eine therapeutische Verbesserung der Blutversorgung wäre denkbar.