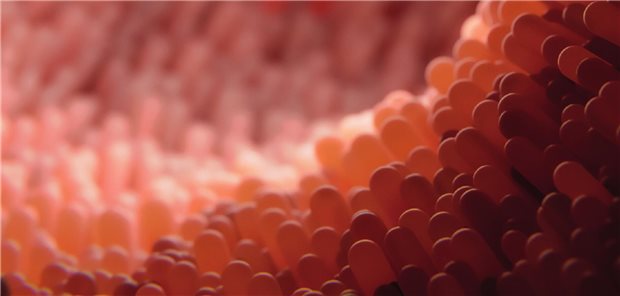Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
Angehörige sterbender Menschen zeigen teils klinisch relevante Belastung
Fast die Hälfte der Angehörigen von Patientinnen und Patienten in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sind psychosozial stark belastet, besagt eine Studie aus Norddeutschland.
Veröffentlicht:Hannover. Gerade in der häuslichen Versorgung kommen die Bedürfnisse der Hauptbezugspersonen palliativ versorgter Menschen oft zu kurz. Um den fordernden Alltag mit ihren sterbenden Angehörigen zu bewältigen, brauchen sie praktische Informationen, aber vor allem wirksame Strategien, um ihre emotionale Stabilität zu bewahren oder wiederherzustellen.
In der Palliativversorgung müssen sich nahestehende Angehörigen nicht nur mit dem Sterben und kommendem Verlust eines geliebten Menschen auseinandersetzen. Gerade im ambulanten Setting haben sie auch dessen Alltag zu organisieren, von der Terminplanung über Bankgeschäfte bis zur Lagerung und Betreuung in unruhigen Nächten. Das kann schnell überfordern.
Für die Diplom-Soziologin Anneke Ullrich, die am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Palliativmedizin forscht, ist klar: Die Mitversorgung der Angehörigen gehört zum ganzheitlichen Ansatz der Palliativmedizin und zur psychosomatischen Grundversorgung dazu.
Monozentrische Fragebogenstudie
Weil die Wissenslücken in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) noch größer sind als im stationären Kontext, hat Ullrich mit ihren Kolleginnen und Kollegen in einer monozentrischen Querschnittsstudie untersucht, welche psychischen Belastungen, Unterstützungsbedürfnisse und Ressourcen Angehörige am Anfang einer SAPV haben.
Dafür rekrutierten sie über ein SAPV-Team in Ostfriesland konsekutiv 76 erwachsene Hauptbezugspersonen erwachsener Patientinnen und Patienten und befragten sie binnen 72 Stunden nach Beginn der SAPV. Mit verschiedenen validierten Messinstrumenten erfassten sie:
- psychosoziale Belastungen
- Ängstlichkeit
- Depressivität
- gesundheitsbezogene Lebensqualität
- Verfügbarkeit sozialer Unterstützung
- Art und Anzahl wichtiger Kraftquellen
Die Angehörigen waren 26 bis 83 Jahre alt, im Mittel 62. 63 Prozent waren Frauen. Etwas mehr als die Hälfte waren Ehepartner und 37 Prozent erwachsene Kinder. 57 Prozent waren im Ruhestand.
Klinisch relevante Belastung, viele Bedürfnisse
Von 23 vorgegebenen Problemen waren Erschöpfung, Traurigkeit, Sorgen, Ängste und Schlafstörungen die häufigsten, bei jeweils mehr als der Hälfte. Auf dem „Distress-Thermometer“ von 0 (gar nicht belastet) bis 10 (extrem belastet) erreichten rund 80 Prozent Werte ≥ 5, eine Belastung, die laut Ullrich „eigentlich klinisch so relevant ist, dass sie durch weitere psychosoziale Berufsgruppen unterstützt werden müssten“. Bei je rund einem Drittel gab es zumindest Hinweise, dass eine Angst- oder depressive Störung vorliegen könnte.
Die gesundheitsbezogene Lebensqualität fiel in allen Kategorien geringer aus als in einer alters- und geschlechtsadjustieren Normstichprobe, vor allem beim psychischen Wohlbefinden, der emotionalen Rollenfunktion, sozialer Funktionsfähigkeit und Vitalität.
Im Mittel fanden die Befragten 18 von 20 vorgegebenen Bedürfnissen sehr und extrem wichtig, durchschnittlich sieben blieben unerfüllt. Zwei stachen hervor:
• wissen, was zu erwarten ist, wenn Symptome auftreten
• Hoffnung spüren
Wichtige Ressourcen: Beziehungen und Helfen-Können
„Wir sehen, dass es Angehörigen wirklich nicht gut geht“, sagte Ullrich. Auf der Haben-Seite berichteten 46 Prozent über eine hohe und 32 Prozent immerhin noch über moderate soziale Unterstützung. Ullrich: „Das ist auf jeden Fall etwas, was eine Ressource darstellen kann.“
Die drei wichtigsten Kraftquellen waren:
• Beziehungen zu Familie und Freunden/Freundinnen pflegen in 81 Prozent
• Gefühl finanzieller Sicherheit in 71 Prozent
• Für andere da sein in 68 Prozent
Die hohe Gewichtung sozialer Beziehungen sieht Ullrich auch als „Auftrag an uns, dass wir da gemeinsam mit den Angehörigen ein bisschen schauen, wie wir sie dabei unterstützen können. Denn das Fallenlassen sozialer Beziehungen in so einer angespannten Situation geht sehr schnell – und auch das Fallengelassen-Werden.“
Möglichkeiten, Angehörige zu unterstützen:
- Beratung zu regionalen und ortsunabhängigen Unterstützungsangeboten
- Belastungen und Ressourcen frühzeitig und regelmäßig erfragen – „Wie geht es Ihnen eigentlich?“ – und mit geeigneten Messinstrumenten erfassen.
- Einbindung Ehrenamtlicher oder ambulanter Hospizdienste
- mit den Angehörigen deren bestehendes Umfeld visualisieren – „Manchmal detektiert man da noch Personen, die ganz vergessen worden sind.“
- Fragen: „Was gibt ihnen Kraft?“ und zur Aufrechterhaltung auch kleiner Kraftquellen ermutigen
- Perspektivwechsel: Mitunter tun sich neue Kraftquellen auf, etwa persönliches Wachstum durch Meistern der schwierigen Situation