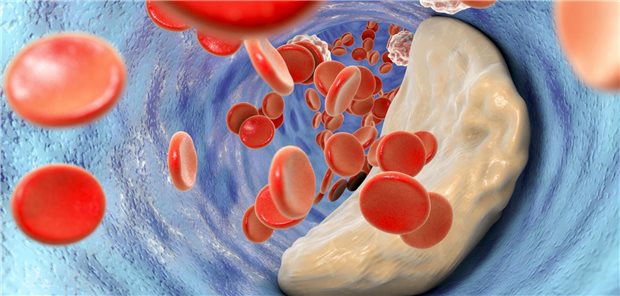HINTERGRUND
Die Neigung zu Übergewicht wird schon in die Wiege gelegt
Die Verbreitung der Adipositas erreicht epidemische Ausmaße. Besonders alarmierend ist die steigende Zahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher. Wer als Kind dick ist, ist es oft auch als Erwachsener. Da Übergewichtige bekanntlich nur schwer von ihrem Gewicht herunterkommen und ein hohes Risiko etwa für kardiovaskuläre Erkrankungen haben, wird Prävention der Adipositas immer wichtiger. Und die kann nicht früh genug beginnen. Denn die Weichen für späteres Übergewicht werden schon bei Säuglingen gestellt. So haben nach Studienergebnissen gestillte Kinder eine um 20 bis 35 Prozent niedrigere Wahrscheinlichkeit für Übergewicht als nicht gestillte Kinder.
Die meisten Studien haben ergeben, daß Stillen schützt
In je einer Publikation haben Professor Karl Zwiauer vom Zentralklinikum St. Pölten in Österreich sowie Dr. Doris Oberle vom Dr. von Haunerschen Kinderspital in München Untersuchungen zum Zusammenhang von Stillen und Übergewicht bewertet (Monatsschr Kinderheilkd 151 (Suppl 1), 2003, S84/ S58). Nach Angaben Zwiauers haben acht von elf Studien einen protektiven Effekt des Stillens ergeben.
Wie Oberle berichtet, beruht die erste große Studie zu Stillen und Übergewicht auf Einschulungsuntersuchungen im Jahr 1997 in Bayern. Analysiert wurden Daten von 9357 fünf- und sechsjährigen Kindern. Ihre Eltern füllten Fragebögen zur Ernährung ihrer Kinder in den ersten Jahren, zu aktuellen Eßgewohnheiten und zum Lebensstil aus. Von den Kindern, die nie gestillt worden waren, waren 4,5 Prozent adipös mit einem Body Mass Index (BMI) über der 97. Perzentile.
Von den gestillten Kindern waren es nur 2,8 Prozent. Bei einer Stilldauer bis zu zwei Monaten waren 3,8 Prozent adipös, bei drei bis fünf Monaten 2,3 Prozent, bei sechs bis zwölf Monaten 1,7 Prozent und bei mehr als zwölf Monaten 0,8 Prozent. Oberle: "Der protektive Effekt des Stillens war nicht auf Unterschiede im sozioökonomischen Status oder Lebensstil zurückzuführen."
Ähnliche Ergebnisse brachten weitere Querschnitts- und auch prospektive Studien. In einer Studie in Dresden und München, in der in erster Linie Risiken allergischer Erkrankungen erfaßt werden sollten, wurden 918 Kinder von der Geburt bis zum Alter von sechs Jahren untersucht. Bei gleichem mittleren BMI bei Geburt hatten mit der Flasche ernährte Kinder bereits mit drei Monaten einen deutlich höheren BMI und eine größere Hautfaltendicke als gestillte Kinder. Bei gestillten Kindern waren mit sechs Jahren die Raten von Übergewicht und Adipositas nur halb so hoch wie bei nichtgestillten.
Wiederanstieg des Gewichts ist ein zuverlässiger Prädiktor
Außer der Ernährung mit der Flasche gehörten in der Studie Übergewicht der Mutter, Rauchen in der Schwangerschaft und niedriger sozioökonomischer Status zu den wichtigsten Risikofaktoren. Oberle: "Frühes Zufüttern von Flaschennahrung begünstigt einen Wiederanstiegs des BMI im Alter von fünf bis sechs Jahren (obesity rebound). Und der wird als zuverlässiger Prädiktor für das Adipositasrisiko im Erwachsenenalter angesehen."
Worauf die mögliche Schutzwirkung des Stillens zurückgeht, ist bislang ungeklärt. Vermutet wird, daß gestillte Kinder die Energiezufuhr regulieren können. Zudem enthält die Muttermilch zum Beispiel Wachstumsfaktoren und Tumornekrosefaktor alpha, die die Anlage von Fettgewebe hemmen können, sowie das Sättigungsenzym Leptin. So sind auch Leptinkonzentrationen im Serum gestillter Säuglinge deutlich höher als bei solchen, die Formulanahrung erhalten.
Künstliche Milchnahrungen sind energie- und nährstoffreicher als Muttermilch. Daher führen sie postprandial zu deutlich höheren Insulinspiegeln, was wiederum die Fetteinlagerung begünstigt und nach Ansicht der Wissenschaftler die frühe Entwicklung von Fettzellen fördern könnte.
Letztlich ist eine positive Energiebilanz entscheidend für die Adipositas-Entwicklung. Zwiauer: "Aus Nahrungspräferenz-Untersuchungen wissen wir, daß gerade Kinder und Jugendliche das essen, was ihnen schmeckt. Und das sind nun einmal süße, fettreiche Nahrungsmittel. Wegen der permanenten leichten Verfügbarkeit dieser Nahrungsmittel und der zunehmenden Inaktivität ist die Wahrscheinlichkeit, daß Übergewicht entsteht, hoch."
Wenngleich er die Bedeutung des Stillens verglichen mit dem Gewicht der Eltern, familiären Ernährungsgewohnheiten und körperlicher Inaktivität als eher gering einschätzt, sieht Zwiauer einen guten Grund, Stillen zu fördern, wenn dadurch bei den Kindern der Adipositas vorgebeugt wird.
FAZIT
Prävention von Adipositas kann nicht früh genug beginnen. Denn die Weichen werden schon bei Säuglingen gestellt. Gestillte Kinder haben nach Studien eine um 20 bis 35 Prozent niedrigere Wahrscheinlichkeit für Übergewicht als nicht gestillte Kinder. Worauf die mögliche Schutzwirkung des Stillens zurückgeht, ist un- geklärt. Vermutet wird, daß gestillte Kinder die Energiezufuhr besser regulieren können. Zudem enthält die Muttermilch nützliche Substanzen wie Leptin, das Enzym, das das Sättigungszentrum beeinflußt.