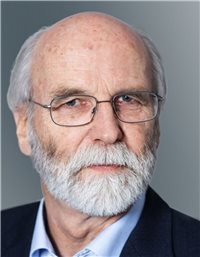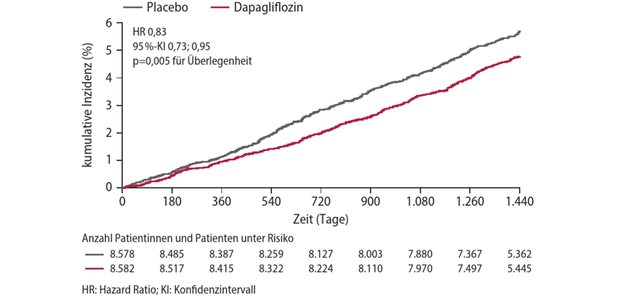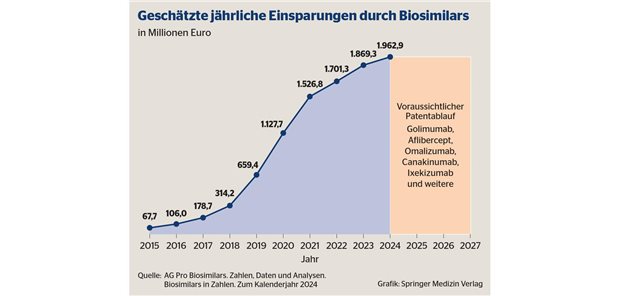Deprescribing
Nach Absetzen von Statinen fühlen sich Schwerkranke oft besser
Schwerkranke mit nur noch geringer Lebenserwartung bewerten den Abbruch einer Statintherapie eher als nützlich. In einer Studie gaben vor allem herzkranke Patienten an, dass sich nach dem Absetzen der Arznei ihre Lebensqualität verbessert habe.
Veröffentlicht:
Polypharmazie im Alter: Bei Patienten mit begrenzter Lebenserwartung lassen sich einige Medikamente gefahrlos absetzen. Entscheidungen dazu müssen aber einfühlsam vermittelt werden.
© Jeff Baumgart - stock.adobe.com
WORCESTER. Australische Epidemiologen haben vor zwei Jahren das Konzept des Deprescribing vorgestellt, bei dem bei Menschen mit Polypharmazie – vor allem bei Älteren – systematisch nach jenen verschriebenen Medikamenten gesucht wird, deren Applikation gefahrlos abgesetzt werden kann(JAMA Intern Med. 2015; 175: 827). US-Forscher, unter anderem von der University of Massachusetts Medical School in Worcester, haben jetzt in einer klinischen Studie untersucht, wie Patienten mit schweren Erkrankungen das Absetzen ihrer Statintherapie beurteilen (J Palliat Med 2017, online 18. Mai).
Fragebogen aus neun Items
An der Studie nahmen fast 300 Patienten teil, die eine Lebenserwartung von nur noch maximal einem Jahr hatten und ein Statin zur Primär- oder Sekundärprävention erhielten. Mit einem Fragebogen wurde die Einstellung der Patienten gegenüber der Entscheidung, die Statintherapie zu beenden, quantitativ erfasst. Die Fragen deckten drei Bereiche im Zusammenhang mit dem Absetzen ab: "möglicher Nutzen", "mögliche Risiken" sowie "andere Vorbehalte". Von den 297 Patienten hatten mit einem Anteil von 58 Prozent die meisten eine Krebserkrankung, acht Prozent kardiovaskuläre Erkrankung und 30 Prozent andere Primärdiagnosen. Die Studienteilnehmer waren durchschnittlich 72 Jahre alt.
Für den potenziellen Nutzen des Statinabbruchs in den Augen der Patienten wurden Antworten bewertet, die die Kosten, die Lebensqualität, die Symptomatik und den Einfluss auf die Einnahme anderer Medikamente betrafen. So sagten manche Patienten, dass sie durch das Weglassen des Statins weniger Symptome hätten oder dass sie möglicherweise auch die Therapie mit anderen Arzneien beenden könnten. Als potenzielles Risiko eines Abbruchs nannten die Patienten, dass sie möglicherweise weitere Beschwerden bekommen könnten, wenn sie das Statin nicht mehr einnähmen.
Andere Vorbehalte eines Therapieabbruchs war die Feststellung, dass man ihnen – den Patienten – bisher stets gesagt habe, nie die Statintherapie zu unterbrechen, und dass der Therapiestopp möglicherweise bedeuten könne, dass der behandelnde Arzt "sie aufgegeben" habe.
Unterschied je nach Primärerkrankung
Aus der Auswertung der Daten geht hervor, dass fast jeder Fünfte (18 Prozent) angab, man habe ihm gesagt, er müsse das Statin bis zum Lebensende einnehmen. Ebenso viele vermuteten, dass ein Statinabbruch ein Zeichen für "vergebliche Mühe" bedeute. 63 Prozent der Patienten sahen eher den finanziellen Vorteil einer solchen Maßnahme, etwa weniger für Medikamente insgesamt ausgeben zu müssen. 34 Prozent gaben an, dass sie hofften, auch andere pharmakologische Behandlungen beenden zu können. Jeder Vierte verband mit dem Statinabbruch eine bessere Lebensqualität. Dabei unterschieden sich die Patientengruppen je nach Primärerkrankung. Signifikant mehr Patienten mit einer kardiovaskulären Erkrankung (52 Prozent) gaben an, dass das Beenden der Statintherapie mit einer verbesserten Lebensqualität verbunden sei. Unter den Krebspatienten lag der Anteil bei 27 Prozent, in der dritten Gruppe ebenfalls.
Deutliche Unterschiede gab es auch bei der Frage nach dem Fortführen der übrigen Medikation nach einem Abbruch der Statintherapie. 61 Prozent der Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen glaubten, dass sie nun auch andere Arzneien absetzen könnten. Bei Krebspatienten waren das 29 Prozent, in der dritten Gruppe 37 Prozent.